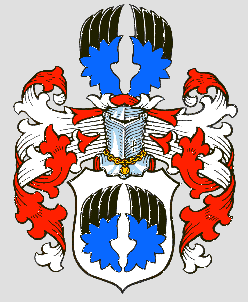
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Voll mechanisiert töten oder getötet werden |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
Von Graudenz wurde ich zur Bordfunkerausbildung in die Nachrichtenschule 1 nach Nordhausen versetzt. Danach, es war im Juni zweiundvierzig, schickte man mich nach Ostpreußen zur Blindflugschule 3 in Grieslienen. Hier nahm ich an zwanzig Schulblindflügen teil. Dabei lernte ich, die in Nordhausen erworbenen theoretischen Navigationskenntnisse in die Praxis umzusetzen. Es ist die Aufgabe des Bordfunkers, bei Nachtflügen jederzeit den Standort des Flugzeugs zu bestimmen, den Kurs zu ermitteln und den Funkverkehr mit den Bodenleitstellen aufrecht zu erhalten. Nachdem die Blindflugausbildung abgeschlossen war, wurde meine Besatzung zusammengestellt, die aus einem Flugzeugführer, einem Bordmechaniker und mir bestand. Jetzt begann für mich der Krieg abenteuerliche Züge anzunehmen, denn wir wurden zum Nachtjagdgeschwader 2 versetzt, das auf Sizilien lag. In Catania führten wir am 20. Juni 1942 den ersten Platzflug mit unserer neuen Ju 88 durch, die unserer Besatzung übergeben worden war. Obwohl streng verboten, flogen wir an den Krater des Ätna nahe heran und warfen einen Blick in den tätigen Vulkan. Schon nach vier Wochen wurde meine Staffel über Rom und München nach Melsbrock in den Niederlanden verlegt. In dem Luftraum zwischen dem Ärmelkanal und dem Ruhrgebiet übten wir eine Luftkampftaktik, die später bei unseren Nachtjagdeinsätzen nicht angewendet werden konnte. Sie entsprach den Luftkämpfen der Tagjäger, bei denen man den Gegner auf weite Entfernung sehen kann. Unsere Luftwaffenführung, die ausnahmslos praktische Luftkampferfahrungen in der Tagjagd hatte, wußte offensichtlich nicht, wie mein Nachtjagdgeschwader einzusetzen sei. Wir übten täglich das Schießen auf Scheiben, den Tagjagdluft[207]kampf, die Nachtlandung und führten Zieldarstellungen durch. Wir waren ständig damit beschäftigt und verbrauchten viel Treibstoff dabei. Bei dreiundvierzig Starts war nicht ein einziger gegen die immer zahlreicher werdenden englischen Bomber gerichtet, die damit begannen, zivile Ziele in Deutschland anzugreifen. Völlig unverständlich war mir der Befehl zur Verlegung nach Südfrankreich in ein Gebiet, in dem es für Nachtjäger keine Kampfaufträge gab. Vom Flugplatz Lezignan aus flogen wir zweimal Seeaufklärung über dem westlichen Mittelmeer mit dem Auftrag, die dort vor Anker liegende französische Flotte zu beobachten. Um dieser zwei Flüge willen, die nach meiner Beurteilung sinnlos waren, denn die französische Flotte hatte sich selbst versenkt, war meine Einheit vom 17. November bis zum 27. Dezember mit einem fieberhaften Flugbetrieb zwischen Südfrankreich, Deutschland und den Niederlanden beschäftigt. Als wir unsere Flugzeuge aus Südfrankreich wieder in die Niederlande überführt hatten, wurde uns ein Führerbefehl bekannt gegeben, der besagte, daß die deutsche Luftwaffe laufend konzentrierte Angriffe gegen Städte in England fliegen solle. Unser Nachtjagdgeschwader wurde daraufhin dem 'Angriffsführer England" einem Kampffliegeroberst unterstellt. Unsere taktische Ausbildung war auf alles mögliche gerichtet, auf Bodenschießen, Tagluftkampf, auf das Beschießen beweglicher Ziele in der Luft, nur nicht auf Bombenabwürfe. Trotzdem erhielten wir den Befehl am 3. Januar 1943, die englische Hafenstadt Hull anzugreifen. So sehr sich meine Feder dagegen sträubt, es hinzuschreiben, um der Wahrheit willen muß ich es tun. Es war an meinem zweiundzwanzigsten Geburtstag, als ich durch einen sinnlosen Befehl dazu gezwungen wurde, mit einem für diesen Kampfeinsatz unausgebildeten Flugzeugführer, mit einer für gezielte Bombenabwürfe nicht ausgerüsteten Maschine nach Hull zu fliegen und dort über der Stadt Bomben abzuwerfen. Unsere Nachtflugerfahrungen reichten aus, das Angriffsziel [208] im Tiefflug über die Nordsee zu erreichen, unsere Bomben ungezielt abzuwerfen und den Heimatfliegerhorst Rheine wieder zu erreichen. Aus Mangel an ausgerüsteten Kampfverbänden blieb der Befehl Hitlers ohne Wirkung. Während wir mit unzulänglichen Mitteln den Luftangriff auf England spielten, wurde in den Fabriken der Insel eine riesige Flotte von viermotorigen Lancesterbombern gebaut, die am 1. März 1943 einen schweren Großangriff mit zweihundertfünfzig Maschinen auf Berlin flog. Währenddessen wurde unser Nachtjagdgeschwader wieder nach Sizilien verlegt. Vom Flugplatz Castelvetrano aus sollten wir nachts feindliche Kampfflugzeuge angreifen, die im nordafrikanischen Luftraum operieren. Wir erhielten den Befehl, solange der Treibstoff reiche, im Frontgebiet auch Bodenziele zu bekämpfen, wenn keine feindlichen Flugzeuge auszumachen seien. In siebzehn Frontflügen hatte meine Besatzung nun erstmalig Gelegenheit, das unter dem Befehl von Feldmarschall Rommel stehende Afrikacorps aus der Luft zu unterstützen. Nach den Einsätzen landeten wir häufig auf einem Flugplatz bei Biserta in Nordafrika. Am nächsten Morgen flogen wir dann nach Castelvetrano zurück, wo wir uns abends für einen erneuten Einsatz bereit hielten. Am 4. März hatte ich mit meinem einhundertzweiunddreißigsten Start zum ersten Mal das Gefühl, in sinnvoller Weise in das Kriegsgeschehen eingeschaltet zu sein. Das dauerte nicht sehr lange, denn Hitler hatte zu der Zeit Nordafrika bereits aufgegeben. Es war ihm nicht entgangen, daß das Afrikacorps den vom Westen her vorrückenden amerikanischen Truppen und den vom Osten seit Oktober 1942 beständig angreifenden Engländern hoffnungslos unterlegen war. Trotzdem wurden bis zu unserem Abflug aus Sizilien riesige Mengen an Nachschub auf dem Luft- und Wasserweg nach Nordafrika geschafft. Am 5. Mai erhielt meine Besatzung den Befehl, eine reparaturbedürftige Ju 88 nach München-Riem zu überführen. Wir entschlossen uns, wegen der technischen Mängel unserer Maschine in Rom nicht zwischenzulanden. Der Flug am italienischen Stiefel entlang über die Poebene und über die Alpen war ein [209] unvergeßliches Erlebnis. Wir sahen München aus dem Dunst des sonnigen Frühlingstages auftauchen. Ich gab die letzte Kurskorrektur an, bis wir den Flugplatz München-Riem vor uns liegen sahen. Dann nahm ich Funkkontakt mit der Flugsicherung auf, die uns sofort die Landeerlaubnis gab. Damit war meine Aufgabe erfüllt. Der Flugzeugführer drehte eine Platzrunde und setzte zur Landung an. Als er die Landeklappen bereits ausgefahren hatte, um mit gedrosselter Fluggeschwindigkeit auf die Landebahn einzuschweben, hörte ich, wie der linke Motor plötzlich mehrmals laut knallte, und sah, wie dessen Propeller immer langsamer rotierte und schließlich stehen blieb. Im gleichen Augenblick schmierte unsere Maschine über die linke Tragfläche ab. Ich sah, wie die Erde mit rasender Geschwindigkeit auf mich zukam, bückte mich in meinem Sitz, soweit es ging, nach vorn und nahm meinen Kopf zwischen die Arme. Der Aufprall, den ich jeden Augenblick erwartete, fand nicht statt. Ich hörte nur Baumäste splittern, den noch laufenden rechten Motor aufheulen und dann ein großes, mir nicht erklärliches Krachen. Als es ruhig geworden war, versuchte ich, aus meiner starken Benommenheit heraus den Flugzeugführer und den Bordmechaniker anzusprechen. Das gelang mir nicht, denn der eine hing bewußtlos über seinem Steuerknüppel, und dem anderen waren die vorne fest eingebauten, automatischen Waffen in den Leib gedrungen. Sein Blut rann aus der seitlich aufgerissenen Kanzel hinaus auf die Tragfläche und tropfte von hier herunter auf den Boden. Ich versuchte, zu erkennen, wo das schmale Rinnsal hinfloß, und sah, daß es ein Grab war. Daraufhin stieg ich aus der Maschine aus und befand mich mitten auf einem Friedhof. Was war geschehen? Zusammen mit einigen Luftwaffensoldaten, die zur Absturzstelle gekommen waren, stellte ich fest, daß wir auf die Baumkronen einer Lindenallee und von dort auf das Fahrwerk unserer Maschine gefallen waren. Der noch laufende Motor hatte uns durch eine Friedhofsmauer hindurch gezogen und war erst stehen geblieben, als unsere Maschine mehrere Bäume umgerissen hatte. Wir wurden in das Revier [210] des Fliegerhorstes gebracht, wo bei meinem Flugzeugführer Lothar Matzner außer Prellungen ein Schädelbasisbruch festgestellt wurde. Der Bordmechaniker Herbert Hunzinger war tot. Außer einigen Hautabschürfungen und einem Schock hatte ich keine Verletzungen. Am nächsten Tag öffnete sich die Tür zu meinem Revierzimmer, und der Flugplatzkommandant trat ein. Über das ganze Gesicht strahlend trug er ein Faß mit Marsalla auf einer Schulter und setzte es vor meinem Bett ab. Das habe er in dem unbeschädigten Heckteil der Maschine gefunden. Im übrigen sei aus den Trümmern nichts zu bergen gewesen. Mein Flugzeugführer wurde in ein Lazarett überführt, ich bekam drei Wochen Heimaturlaub. Meine Mutter war glücklich, ihren Sohn unter ihre Fittiche nehmen zu können, und die Familie war erfreut, den schweren sizilianischen Wein genießen zu können. So einen guten Tropfen hatte man allzu lange entbehren müssen. Es schien so, als ob nach der Rückkehr zu meiner Luftwaffeneinheit man für mich keine Verwendung in der Nachtjagd hatte. Mit einem neuen Flugzeugführer begann für mich in Mainz-Finthen und später in Parchim eine schier endlose Zeit, in der ich nichts anderes tat, als taktische Übungsflüge mit wechselnden Flugzeugführern durchzuführen. Währenddessen steigerten sich die englischen Luftangriffe auf militärische Ziele, Fabriken, Verkehrsanlagen und Wohnbezirke unserer Großstädte. Anfang Dezember wurde meine Staffel zum Fliegerhorst Kassel-Rothwesten verlegt. Von hier aus starteten wir bei jeder Wetterlage, um die nachts im lockeren Verband einfliegenden angloamerikanischen Bomber abzuschießen. Die feindliche Luftwaffenführung schaltete in dieser Zeit mit einer neuen Taktik unsere boden- und luftgestützten elektronischen Ortungsgeräte aus. Das erreichte sie durch den Abwurf von Stanniolstreifen in den Einflugrouten ihrer Bomber. Auf der Röhre unseres Lichtensteingerätes, das wir an Bord hatten, sah man nur ein grelles Flimmern, wenn wir bei Dunkelheit einen Lancesterbomber orten und anfliegen wollten. Un[211]sere erfolgreichen Nachtjäger erprobten deswegen eine neue Angriffstaktik, die später allgemein unter der Bezeichnung "Wilde Sau" eingeführt wurde. Am 16. Dezember flog ich mit meiner Besatzung zum ersten Mal einen Nachtjagdeinsatz mit dieser neuen Taktik. Wir hielten uns solange im Luftraum der angegriffenen Stadt auf, bis die ersten feindlichen Flugzeuge ihre Positionslichter, Phosphorkanister und Brandbomben abgeworfen hatten. Wenn ein Stadtteil lichterloh in Brand geraten war, folgten die Bomber, die in den taghellen Lichtkegel einflogen und dadurch von uns auf weite Entfernung erkannt werden konnten. Wenn sie aus dem Bereich unserer Flak heraus waren und zum Rückflug in die Dunkelheit eintauchten, versuchten wir, sie abzuschießen. Mit dieser Taktik war mein Flugzeugführer erfolgreich. Wir schossen beispielsweise über Frankfurt am Main einen Lancesterbomber ab. Im letzten Augenblick traf der Heckschütze einen unserer beiden Flugzeugmotoren, der in Brand geriet. Da der Luftkampf in großer Höhe stattfand, konnte mein Flugzeugführer den brennenden Motor abstellen und im Sturzflug die Flammen mit dem Fahrtwind löschen. Mit einem Motor flogen wir in etwa fünftausend Meter Höhe in Richtung unseres Heimatfliegerhorstes Kassel-Rothwesten. Plötzlich merkten wir durch leichte Erschütterungen unserer Maschine, daß die deutsche Flak sich auf uns einschoß. Wir sahen, wie die weißen Detonationswölkchen der Granaten sich langsam unserer Maschine näherten. Die Erschütterungen bei den Explosionen wurden immer stärker spürbar. Wir versuchten, nach Osten auszuweichen, hatten aber keine Möglichkeit, uns der Flakstellung gegenüber als deutsches Flugzeug zu erkennen zu geben. Plötzlich beschädigte ein Granatsplitter unsere Maschine so stark, daß der Flugzeugführer sie nicht mehr steuern konnte. Er gab den Befehl zum Aussteigen. Wir warfen einen Teil der Bodenkanzel ab und zwängten uns durch diese Öffnung in das Dunkel des Nachthimmels. So wie ich es gelernt hatte, faßte ich mit der rechten Hand den Griff, der den Fallschirm auslöst, und zählte laut bis zehn. Wäh[212]renddessen überschlug ich mich einige Male, was ich daran sah, daß der klare Sternenhimmel einmal über und dann wieder unter mir war. Nachdem ich den Griff gezogen hatte, öffnete sich der Fallschirm, und ich schwebte lautlos am nächtlichen Himmel. Das war ein sehr angenehmes Gefühl, denn die ärgsten Schrecken schienen hinter mir zu liegen. Ich rückte meinen gelben Seidenschal zurecht und fühlte nach der Taschenlampe, die wir bei Einsätzen an einer Kordel um den Hals trugen. Sie war da, ich nahm sie und leuchtete nach unten. Da war nichts als dunkle Nacht. Mich beschlichen düstere Gedanken, wo ich wohl landen würde, auf einer Baumkrone, an einer Hochspannungsleitung oder in einem Gewässer. Ehe ich den auf mich zukommenden Erdboden im Schein meiner Taschenlampe entdeckte, war ich auf einem freien Feld gelandet. Als Landwirt interessierte mich die Kultur, die dort angebaut war, es war Winterraps. Ich faltete den Fallschirm zusammen, schulterte ihn und versuchte, mich zu orientieren. Ich hörte einen in der Ferne bellenden Hund. Dort mußte ein Dorf sein. In dieser Richtung ging ich einige hundert Meter, als ein Licht schwach durch das Dunkel schimmerte. Nach einer halben Stunde Fußmarsch kam ich in dem Dorf an und klopfte an die Tür des ersten Hauses. Man öffnete mir und empfing mich mit überschwenglicher Freude. Ich war in Gertenroth bei Kulmbach und erfuhr am nächsten Morgen, daß mein Flugzeugführer und mein Bordmechaniker über dem gleichen Dorf mit dem Fallschirm abgesprungen und unverletzt gelandet waren. Wir fuhren mit der Bahn nach Kassel zurück und meldeten uns bei unserem Staffelführer. Insgesamt waren zwei Tage vergangen, bis wir ihm gegenüber standen und er uns trocken sagte: "Wo kommen Sie denn her? Ich habe Sie doch schon als Vermißte nach oben gemeldet." Wir waren auch schon in der Verpflegungsliste gestrichen, und auf meinem Bett stand ein vergrößertes Foto von mir, um das ein Trauerflor geschlungen war. Eine Freundin von der Bildstelle des Fliegerhorstes hatte es hierher gestellt. [213] Vierzehn Tage später, an meinem Geburtstag, dem 3. Januar 1944, mußte ich wieder nach einem Nachtjagdeinsatz mit dem Fallschirm abspringen. Dieses Mal blieb ich mit meiner Fliegerkombination im abstürzenden Flugzeug hängen und konnte mich erst in zweihundert oder zweihundertfünfzig Meter Höhe über dem Erdboden von ihm lösen. Ohne die vorgeschriebenen zehn Sekunden Wartezeit zog ich den Griff, der Fallschirm öffnete sich, und in derselben Sekunde war ich in ein Gewässer gefallen, das sich später als ein Kanal herausgestellt hatte. Auf beschwerlichen Wegen, bei denen ich mehrere Gräben durchwaten mußte, kam ich schließlich in Elsfleth, einem kleinen Dorf bei Oldenburg, an. Eine Bäuerin nahm mich dort in ihre Obhut. Der Flugzeugführer, Oberfeldwebel Winn, war ebenso wie ich rechtzeitig abgesprungen und gut gelandet. Der Bordmechaniker, Oberfeldwebel Rothehuser, hatte nicht rechtzeitig seinen Fallschirm öffnen können. Man fand ihn einige Tage später. Er hatte sich beim Aufprall auf den Erdboden das Rückgrat gebrochen. Mein Weltbild, das ich mir zurecht gezimmert hatte, brach in diesen Monaten zusammen. Wenn ich Flugzeugführer gewesen wäre, hätte ich damals einen hart auf hart gehenden Kampf gesucht. Als Bordfunker blieb mir nichts anderes übrig, als meine begrenzte Arbeit zu tun und das, was um mich herum geschah, aufmerksam zu beobachten. Ich war über Essen, Hamburg, Dresden, Berlin, Frankfurt, Mannheim, Hannover, München geflogen, während sich einige tausend Meter unter mir apokalyptische Szenen abspielten. Wenn ich es versuchen würde, sie in ihrer unbeschreiblichen Faszination zu berichten, entstände wahrscheinlich ein grausig-schönes Bild, in dem das hunderttausendfache menschliche Leid und Sterben der Greise, Frauen und Kinder nicht in angemessener Weise zur Geltung käme. Für mich waren die Szenen eine ungeheure Herausforderung meines Menschseins. Hatte dies noch mit einem fairen soldatischen Kampf zwischen zivilisierten Völkern zu tun? In diesem Krieg der voll mechanisierten Armeen war, war der Soldat gezwungen, anonym zu tö[214]ten oder er wurde getötet, ohne je das Weiße im Auge des Feindes gesehen zu haben. Die Kriegspartei siegte, die die meisten Waffen, die größte Tötungskapazität, die menschenverachtendsten Methoden aufbieten konnte. Die Luftüberlegenheit der Angloamerikaner wurde immer größer. Sie flogen ihre Bombeneinsätze in riesigen Verbänden am Tage. Die Nachtjäger wurden vierundvierzig zur Tagjagd eingesetzt. Dabei blieb unsere Staffel ohne jeden Erfolg. Wenn wir uns den Bombergeschwadern mit unseren schwerfälligen Ju 88 näherten, gerieten wir in einen undurchdringlichen Feuerzauber der Jäger und der Bordkanonen. Einige Flugzeugführer anderer Nachtjagdstaffeln waren selbstmörderische Draufgänger. Sie schossen mit allen Bordwaffen, bis die Munitionsmagazine leer waren, rammten anschließend ein oder zwei Bomber und stürzten mit ihrem letzten Opfer zusammen ab. Mir ließ zwischen den Einsätzen die Frage keine Ruhe, warum Gott die sinnlose Apokalypse des Bombenkrieges zuließ. Die Ideale meiner Jugend, meiner christlichen und humanistischen Erziehung hielten angesichts der Vorgänge um mich herum nicht stand. Also, so dachte ich damals, hatten die deutschen Denker des 19. Jahrhunderts recht, Ludwig Feuerbach und David Friedrich Strauß, die die Grundwerte des Christentums in Frage stellen, Karl Marx, der die Religion zum Opium für das Volk erklärt, und schließlich Friedrich Nietzsche, dessen radikale Zeitkritik das Erdbeben unserer Epoche ankündigt. In unüberbietbarer Selbstüberschätzung machte ich mich daran, die Welt, wie sie sich mir darstellte, in Gut und Böse, in zwei gegeneinander scharf abgegrenzte Fronten einzuteilen. Ich schrieb zwei Zeitungsartikel und merkte nicht, daß ich mich in die Sackgasse der Säkularisation und des von Nietzsche angekündigten Nihilismus verrannt hatte. Meine Religion war Trotz vor Gott. Was in mir vorging, war keine Umwertung, es war ein Verfall aller Werte. In diesem Zustand schrieb ich am 28. Dezember 1944 einen Brief. Meine liebe Mutti, nun ist Weihnachten wieder vorbei, und ein neues Jahr steht vor der Tür. Dazu wünsche ich Dir alles Gute, möge es Dir Gesundheit und Erfüllung Deiner Wünsche [215] bringen, so daß Du befriedigt Deinen Pflichten nachgehen kannst, mit deren Erfüllung Du Dich fortwährend überforderst. Vielen Dank für das Weihnachtspäckchen. Sehr vermißt habe ich aber einen Brief von Dir. Es war kein Wort eingelegt. Ich habe schon seit einigen Wochen keine Post mehr von Dir. Verstehst Du mich in irgendeinem Punkte nicht? Dann frage doch bitte. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es zu Hause aussieht und wie es Dir geht. Ich gestehe offen ein, daß ich dem ganzen Gedankenkreis, in dem Du lebst, entrückt bin, aber dafür kann ich nichts. Vor kurzem habe ich den Artikel "Gut und Böse" an den Führungsstab der Wehrmacht geschickt und vor Weihnachten ein Schreiben zurückbekommen, in dem zum Ausdruck kommt, daß er als "sehr bemerkenswerter Artikel" an die Schriftleitung weitergeleitet worden sei. Zu meinem zweiten Aufsatz "Wahres Soldatentum" erhielt ich ein Schreiben, in dem es heißt: "Wir danken für Ihren Aufsatz, in dem viele gute Gedanken sind. Wir werden ihn im Rahmen der Arbeit des 'Politischen Soldaten' demnächst verwenden." Wenn er gedruckt wird, bekäme ich noch Bescheid. Ich lege den Aufsatz heute in den Brief mit ein. Mutti, aus allem wirst Du sehen, daß es besser ist, auf niederem Posten zu verweilen, als durch Unredlichkeit etwas zu werden. Vor Weihnachten habe ich eine Meldung abgegeben, in der ich um die Ausbildung zum Flugzeugführer bat. Wenn ich dabei Erfolg hätte, wäre ich glücklich. Aber ich habe bisher immer Glück im Leben gehabt und glaube daran, daß ich endlich zum persönlichen Einsatz komme und dann zeigen kann, ob ich ein ganzer Kerl bin. Mutti, es müßte für eine deutsche Frau leichter sein, von drei Söhnen zwei zu verlieren, als zu sagen, daß einer ein Feigling ist. In diesem Sinne wollen wir das neue Jahr beginnen. Viele Grüße, Dein Sohn. Einsatzbefehle wurden fünfundvierzig immer seltener gegeben. Dafür flogen wir umso häufiger auf einen gut getarnten Ausweichflugplatz, um unsere Maschinen vor den Bombenabwürfen und Tieffliegerangriffen in Sicherheit zu bringen. Dieser [216] Einsatz der deutschen Luftwaffe wurde bezeichnenderweise "Blindschleiche" genannt. Meine Schwester Edith war mit ihrem Treck dicht an dem Fliegerhorst Parchim vorbeigefahren. Sie wollte mich hier treffen, bekam aber bei der Hauptwache die Auskunft, ich sei mit meiner Einheit am Vormittag des gleichen Tages auf einen Flugplatz in der Lüneburger Heide verlegt worden. Man gab ihr meine neue Feldpostnummer, so daß sie mir schreiben konnte, als sie nach Beendigung ihrer Flucht nach Bokel eingewiesen worden war. Mir hatte dieser Ortsname im Kreis Wesermünde damals nichts gesagt, und trotzdem sollte er in meinem Leben später eine große Rolle spielen. Soweit sind wir aber noch nicht. Ab Februar fünfundvierzig flogen wir keine Einsätze mehr. Die angloamerikanische Luftüberlegenheit war erdrückend geworden. Das fliegende Personal meiner Einheit wurde zu Fuß in Richtung Neuruppin in Marsch gesetzt. Den Befehl dazu gab uns bei dem letzten Appell meiner Luftwaffeneinheit der Geschwaderkommodore, ein Major, der nur vier oder fünf Jahre älter war als ich. Er machte bei seiner Rede den Eindruck eines etwas zu alt gewordenen Hitlerjungen, der mit schnarrender Stimme herunterleierte, daß der Krieg verloren, daß eine Führerreserve zu bilden und deswegen das fliegende Personal zum Kampf um Berlin zusammenzuziehen sei. Der Sinn unseres Kampfes sei es gewesen, den Verderber der abendländischen Völker, das internationale Judentum, zu vernichten. Dieses Ziel sei in Europa erreicht worden. Da ist es wieder, dachte ich, dieses eindimensionale, krankhafte Denken, mit dem Hitler Deutschland und Europa zugrunde gerichtet hat. Wir Unteroffiziere und Mannschaften wurden nach Berlin in Marsch gesetzt. Ein höherer Offizier meines Geschwaders ließ sich dort nicht blicken. Du wärst verrückt, dachte ich, Dich für ein von Hitler mißbrauchtes Vaterland zu opfern. Jetzt solltest Du nur Fakten sammeln und Deine Gedanken nach dem Kriege neu ordnen. Später wirst Du studieren, einen normalen Beruf ausüben und, sobald es möglich ist, ein Buch schreiben. Jetzt mußt Du an das Nächste denken und das [217] Chaos überleben. Ich erinnere mich nicht mehr, ob wir drei oder vier Wochen unterwegs waren. Oft mußte unsere Gruppe, der sich einige Luftwaffenhelferinnen angeschlossen hatten, im Straßengraben in Deckung gehen. Wir marschierten durch Mecklenburg, während etwas südlicher von uns die englischen Frontverbände auf Berlin vorstießen. In Neuruppin angekommen, meldeten wir uns befehlsgemäß in einer Kaserne. Dort wurden sogenannte Hundertschaften zusammengestellt, mit Handfeuerwaffen und Panzerfäusten ausgerüstet und in die Kesselschlacht von Berlin geschickt. Es gelang mir, mich von diesem zusammengewürfelten, nur zum kleinen Teil bewaffneten Haufen abzusetzen. Im Grunde interessierte es niemanden mehr, ob ich in Richtung auf das eingeschlossene Berlin mitmarschierte oder untertauchte. Ich holte die Feldpostkarte meiner Schwester Edith hervor und las zum zweiten Mal den Namen Bokel. Altthorn war längst von den Russen besetzt und meine Familie aus der Heimat geflohen. Wo sollte ich mich hinwenden? Wo war mein Zuhause? "Komm mit", sagte ein Kamerad zu mir, der ebenso unschlüssig war wie ich, "wir setzen uns nach Hamburg ab." In wenigen Tagen waren wir dort und meldeten uns pflichtgemäß in einer Kaserne. Hier hörten wir am Radio, daß die deutsche Wehrmacht kapituliert, Hitler Selbstmord begangen hatte und eine neue Reichsregierung eingesetzt worden sei. Es war der 2. Mai 1945. Am nächsten Tag wurde die Kaserne von englischen Truppen besetzt. Sämtliche deutsche Soldaten, die in Hamburg in Gefangenschaft geraten waren, wurden in Güterzügen in das Gefangenenlager Schleswig-Holstein transportiert. Der Zug hielt auf freiem Felde. Ich stieg aus und versuchte, mich zu orientieren. Wir waren in der Nähe von St. Michaelisdon. Die wildesten Parolen schwirrten durch die Gegend. Nur die englischen Bewacher hüllten sich in Schweigen. Verpflegung gab es nicht, und ein Dach über dem Kopf mußte sich jeder auf eigene Faust suchen. Wir quartierten uns in der Scheune eines Bauernhofes ein. Sie war so stark belegt, daß es sehr schwierig war, einen freien Quadratmeter mit Strohunterlage [218] zu finden. Nach langem Suchen gelang es uns. Am nächsten Tag fanden wir sogar in der Scheuneneinfahrt einen Haufen mit halb verfaulten Steckrüben. Ich ergatterte eine, schnitt die vergammelten Stellen weg, verspeiste mit Genuß eine Scheibe und steckte den Rest in meinen Brotbeutel. Deutsche Landser sind nicht tot zu kriegen, sie wissen sich in allen Lebenslagen zu helfen. Als wir bis Pfingsten alle Reserven aufgegessen und unser Quartiergeber Speicher und Vorratsräume unwiderruflich verschlossen hatte, tat sich eine Gruppe zusammen und kaufte einen uralten, lahmen Schimmel. Er wurde geschlachtet und in den folgenden Wochen in der Lehrküche der Landwirtschaftsschule stückweise gar gekocht. Wer da glaubt, dies wäre ein leichtes Unterfangen, der hat noch keine Erfahrungen mit zähem, altem Pferdefleisch gemacht. Wir lernten bald, daß es nicht zwei oder drei, sondern vier oder fünf Stunden gekocht werden mußte. Auch dann bekamen wir es nur gar, wenn wir das Fleisch in möglichst kleine Würfel schnitten. Ich sammelte täglich junge Brennesseln in mein Kochgeschirr, ließ mir zur Mittagszeit eine Kelle voll Pferdegulasch darüber kippen und setzte mich zum Essen hin. Manchmal gelang es mir nicht, trotz eifrigen Bemühens, die Fleischstücke klein zu kauen. Die Soße war aber kräftig und machte meine Brennesselkost genießbarer. Die Landwirte wurden zuerst entlassen. Am 15. Juli wurde ich zur Lagerverwaltung bestellt. Der englische Kommandant händigte mir zusammen mit dem Entlassungsschein ein deutsch verfaßtes Schreiben aus. Unvergeßlich bleiben mir drei Sätze, die ich sinngemäß wiedergebe: "Deutschland hat den von Hitler angezettelten Krieg verloren. Die jüngeren Männerjahrgänge sind weit über die Hälfte tot. Das deutsche Volk ist biologisch in dieser und in der nächsten Generation so schwach, daß es keinen eigenen Staat mehr aufrichten kann. Es hat durch eigenes Verschulden das Recht darauf verwirkt." Ich leistete meine Unterschrift, erhielt die Entlassungspapiere und war frei. Auf dem Weg zu meiner Schwester Edith [219] nach Bokel, den ich auf Lastwagen, mit dem Zug und strekkenweise auch zu Fuß zurücklegte, las ich mein Entlassungsschreiben immer wieder von neuem durch. Dabei wurde mir klar, daß die angelsächsischen Politiker im Schlepptau von Franklin Roosevelt das gefährliche Monster Hitler und sein diktatorisches Regime beseitigen, was sie aus Gründen der Kriegspropaganda in den Vordergrund gestellt hatten, aber auch das Deutsche Reich in seinem Kern zerstören wollten. Dieses angloamerikanische Kriegsziel gab den Beschlüssen von Casablanca und später von Jalta ihren eigentlichen Sinn. Roosevelt war jetzt schon seit vier Monaten tot. Hitler hatte gehofft, dessen Nachfolger würde Stalin durchschauen und aus der Allianz mit der Sowjetunion ausscheren, bevor sie den Balkan, die baltischen Staaten, Polen, die Tschechoslowakei und den überwiegenden Teil Österreichs und Deutschlands militärisch besetzt hatte. Harry Truman setzte aber die Politik seines Vorgängers fort, anstatt Barrieren zur Eindämmung der sowjetischen Expansion in das Herz Europas hinein zu errichten. Erst einige Jahrzehnte später, nachdem ich die "Erinnerungen" von Carlo Schmidt(13)und das Buch "Die Junker" von Walter Görlitz(14)gelesen hatte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Die alliierten Staatsmänner sahen in dem preußischen Adel den Träger des neudeutschen Militarismus, die Steigbügelhalter Hitlers, die kriegslüsternen Feinde des Weltfriedens und des Glücks der Menschheit. Deswegen haben sie den deutschen Osten dem Bolschewismus als Kriegsbeute überlassen. "Geschichte ist das Weltgericht", sagt Hegel. Damals verstand ich die Motive der westlichen Politiker nicht, die sich in der Atlantikcharta feierlich zur abendländischen Kultur und Zivilisation bekannt hatten. War das reiner Zynismus? Meine Familie hatte seit fünf Jahrhunderten in Osteuropa gelebt und gearbeitet. Sie hatte sich dort als Vorposten der christlich geprägten, abendländischen Kultur empfunden. Mit uns mußten einige Millionen bürgerliche und bäuerliche Familien aus ihren angestammten Siedlungsgebieten fliehen oder wurden aus ihnen vertrieben. Die westlichen Demokratien gingen [220] weit über die Zugeständnisse, die Hitler der Sowjetunion kurz vor Kriegsbeginn gemacht hatte, hinaus. Die traditionelle Politik des Gleichgewichts der Kräfte in Europa war damit gescheitert. Mit diesen pessimistischen Gedanken ohne Glauben und Hoffnung kam ich auf dem Bahnhof Stubben an. Der Bahnbeamte zeigte mir den Weg nach Bokel. Wo dort meine Schwester Edith Feldt wohne, wollte ich wissen. Er konnte es mir nicht sagen. So ging ich in meinen Knobelbechern, in Luftwaffenuniform ohne Rangabzeichen, mit Brotbeutel und eingerolltem Soldatenmantel am Koppel, einem grauen Schlapphut auf dem Kopf, nach Bokel und fragte mich dort bis zu meiner Schwester durch. |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|