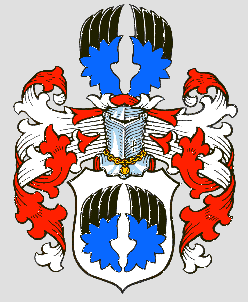
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Euch wird das Lachen schon vergehen |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
In meiner Familie wurde viel gelacht. Die schönsten Stunden meiner Jugend waren die, in denen am gemeinsamen Wohnzimmertisch eine ungezwungene Heiterkeit ausbrach. Wir hatten uns zum Abendbrot versammelt, als der Funke wieder einmal übersprang. Irgend jemand aus der großen Runde, ich erinnere mich nicht mehr, wer es war, machte den Vorschlag, wir sollten doch einmal ein expressionistisches Abendessen veranstalten. Mein ernsthafter Vater drehte sofort seinen Stuhl um, so daß die Lehne an den Tisch stieß, setzte sich im Reitersitz wieder hin und legte das Kinn auf die Stuhllehne. Dann schmierte er sich in dieser Stellung ein Brot und biß einen Happen ab. Beim Kauen ging sein Kopf immer hoch und runter, hoch und runter. Das wirkte komisch und ansteckend zugleich. Jeder von uns dachte sich eine Eßweise aus, die mehr unseren Haustieren glich als den uns anerzogenen Tischmanieren. Opa schlang zu große Bissen herunter wie ein Storch, der gerade einen dicken Frosch gefangen hatte und bei dem man an der Verdickung des Halses sah, wo er sich auf dem langen Weg zum Magen gerade befand. Oma war für Späße dieser Art sehr aufgeschlossen. Sie schleuderte meinem [121] Großvater, der noch an den zu großen Brocken würgte, ins Gesicht: "Warum schluckst Du wieder wie ein Storch? Kannst wohl den Hals nicht voll genug bekommen." Sie schnitt sich die mit Wurst belegten Brote in winzig kleine Häppchen, spießte sie geziert mit der Gabel auf und führte sie mit weit abgespreiztem kleinen Finger in den nur mäßig geöffneten Mund, so wie die feinen Damen es tun. Meine Mutter schleckte die Milchsuppe aus dem Teller auf und leckte ihn dann blank wie eine Katze. Meine Schwester Ursula verfolgte zunächst das verrückte Treiben angewidert. Dann holte sie die selbstgemachte Marmelade aus dem Buffet, die sonst nur besonderen Anlässen vorbehalten war, aß sie mit dem Teelöffel und leckte die Reste wie ein Hund mit langer Zunge ab. Dabei grunzte sie voll Wohlbehagen. Meine Schwester Edith konnte natürlich nicht fehlen. In der Zeit war sie gerade sehr gewachsen. Ich wußte, wie ich sie am besten packen konnte, und sagte wieder einmal: "Du wirst aussehen wie die Heringsfrau in Thorn." Edith ärgerte das nicht. Sie imitierte vielmehr die Witzfigur, indem sie vom Tisch aufstand, einen langen Hals machte, was ihr nicht schwer fiel, und symbolisch Heringe aus einem tiefen Faß hervorholte. Mein Großvater machte eine Zeitlang mit. Dann fand er uns zu albern und sagte mit seiner tiefen Stimme: "Lacht man, lacht. Euch wird das Lachen noch vergehen." Opa hatte einen trockenen Humor. Nach dem Frühstück, bei dem er regelmäßig die "Deutsche Rundschau" las, ging er auf den Hof, in die Ställe oder in die Obstgärten, um sich dort nützlich zu machen. Eines Tages beobachtete ihn mein Vater, wie er in einer Pferdebox versuchte, die Fohlen zu putzen. Sie waren kurz vorher von den Stuten abgesetzt worden und deswegen noch besonders schreckhaft und wild. Mein Großvater ließ aber nicht locker und versuchte, sich einem Fohlen mit der Bürste zu nähern. Es beäugte ihn aufmerksam, legte die Ohren an und drehte ihm blitzschnell das Hinterteil zu. Mein Vater sah das und sagte zu ihm, er könne in seinem Alter doch nicht so unvernünftig sein, allein in die Fohlenbox zu gehen. Er befand sich damals im siebenundachtzigsten Lebens[122]jahr. Ob er denn nicht wisse, was alles passieren könne. Opa entgegenete ihm trocken:. "Ja, flink muß man schon sein." Dann folgte im belehrenden Tonfall, sein Schwiegersohn könne, so wie er es mache, keinen Erfolg bei Fohlenaufzucht erzielen. Die jungen Tiere müßten jeden Tag rausgelassen und geputzt werden, damit sie an die frische Luft kämen und sich an die Menschen gewöhnten. Meinen Vater ärgerten die im nörgelnden Tonfall vorgebrachten Ratschläge. Er wollte in diesem Augenblick nicht zugeben, wie recht sein Schwiegervater hatte und wie er dessen hagere, elastische Gestalt bewunderte. Die Nachteile des Zusammenlebens von drei Generationen unter einem Dach wurden durch unzählige Vorteile aufgewogen. Wenn wir Kinder mit unseren Eltern eingeladen waren, achteten meine Großeltern auf Haus, Hof und Tiere. Mein Großvater ging dann abends noch einmal durch die Ställe und blieb solange wach, bis wir nachts nach Hause kamen. Als wir einmal nach Mitternacht zurückkamen, sahen wir im Wohnzimmer noch Licht brennen. Opa war also noch nicht schlafen gegangen und hatte wieder einmal seine Aufgabe verantwortungsvoll ausgeführt. Meine Mutter schloß die Haustür auf und ging voraus, mein Vater, meine vier Geschwister und ich hinterher. Als meine Mutter die Wohnzimmertür aufgemacht hatte, rief sie erschreckt: "Mein Gott, Opa, was ist denn mit Dir los." Wir stürzten in das Wohnzimmer, um zu sehen, was geschehen sei. Unser würdiger Großvater mit seinem fast weißen, kurz gestutzten Vollbart hatte sich in unserer Abwesenheit auf wunderbare Weise verwandelt. Am Wohnzimmertisch saß ein jugendlich wirkender Mann, der die Zeitung weglegte, seine Nickelbrille auf die Stirn schob und unsere erstaunten Gesichter verständnislos ansah. Wir brachen in schallendes Gelächter aus, denn Opas noch volles Kopfhaar, die Augenbrauen und vor allem der Bart waren pechschwarz. Meine Mutter sah, was geschehen war. Sie stürzte zur Petroleumlampe, die über dem Wohnzimmertisch hing, und drehte den Docht herunter. Opa war so in die Zeitungslektüre vertieft, daß er nicht bemerkt hatte, als die Lampe zu blaken anfing. [123] Nach ein oder zwei Stunden war das Wohnzimmer mit einem dünnen, schwarzen Schleier überdeckt. Der Ruß hatte sich auch in den Haaren unseres Großvaters festgesetzt und die uns sehr erheiternde Verjüngungskur bewirkt.Mein Großvater bezog den eigenen Tod in sein Leben ein. Ich empfand es damals als Marotte von ihm, daß er jeden Abend, wenn er sich in sein Bett legte, sagte: "Schon wieder ein Tag näher zum Grabe." Er hatte seinem Leben ein Ziel gesetzt und wollte seinen neunzigsten Geburtstag im Kreise seiner Familie erleben. Er konnte über seinen eigenen Tod so unbefangen sprechen, weil er ein tiefes religiöses Empfinden hatte. Mein Großvater hörte oft mit Oma zusammen die Morgenandacht, die regelmäßig jeden Sonntag gesendet wurde. Wenn gutes Wetter war, ging er zur Kirche. Nach dem Frühstück holte er den schwarzen "Überzieher", wie er seinen Mantel nannte, zog ihn an, setzte sich den schwarzen Hut auf und ging alleine zur Gursker Kirche. Er machte sich schon so rechtzeitig auf den Weg, weil er vor dem Gottesdienst die Grabstelle der Huhses aufsuchen und ein stilles Gedenken an sein liebes Marthchen [Martha Luise Fenner, * 4.3.1858, °° 18.9.1877, †1.2.1925] einlegen wollte. Es war wohl diese feine, den Härten des Lebens und des Sterbens gegenüber biegsame Art, die unserem Großvater soviel Würde verlieh. Sie wurde von allen Familienmitgliedern respektiert. Manchmal war er meinen Eltern mit seiner übertriebenen Sparsamkeit auch auf die Nerven gefallen. Er hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Gartenabfälle im Herbst zusammenzuharken, mit den trockenen Ästen der Obstbäume zusammen auf einen großen Haufen zu werfen und diesen dann anzuzünden. Eines Tages hatte er die erleuchtende Idee, die trockenen Gartenabfälle nicht einfach nutzlos zu verbrennen, sondern sie in unserem grünen Kachelofen zu verwerten, der das Wohnzimmer und das daneben liegende Zimmer meiner Großmutter beheizte. Er hatte es sicher gut gemeint, denn der kühle Spätherbsttag war so recht dazu angetan, der Familie am Abend ein gemütliches, warmes Zimmer zu gönnen. Er brachte einen großen Arm voll Bohnenkraut in den Hausflur, von wo aus be [124]sagter Ofen zu heizen war, stopfte die Feuerung voll, zündete es an und machte die Eisentür zu. Dann ging er wieder in den Garten zurück, um eine neue Portion zu holen. Inzwischen entwickelte das Bohnenkraut soviel Rauch und Hitze, daß in dem Kachelofen ein riesiger Überdruck entstand. Es gab im Wohnzimmer einen dumpfen Knall. Die Krone des Ofens hob sich einige Zentimeter hoch, und durch den so entstandenen Spalt entwich ein Rauchschwall in das Wohnzimmer. Meine Mutter hatte den Knall gehört. Als sie die Wohnzimmertür geöffnet hatte, kam ihr der Rauch in dicken Schwaden entgegen. Sie dachte, das Haus brenne, und lief so schnell sie konnte zur Haustür, um nach Hilfe zu rufen. Da kam ihr unser Opa mit einem neuen Arm voll Bohnenkraut entgegen. Ich habe die Gesichter von meinem Großvater und seiner Tochter nicht gesehen und kann sie deswegen nur unzulänglich beschreiben. Ich kann mir aber vorstellen, daß das eine Gesicht überstrahlt war vom Glanz eines sehr nützlichen Gedankens und in dem Gesicht meiner Mutter Schreckensbleiche ob des möglichen Brandes und Zornesröte über den sparsamen Vater miteinander um die Vorherrschaft rangen. Später entspannte sich das Gesicht meiner Mutter wieder, denn das Haus brannte nicht. Die Ofenkrone war nach der Explosion wieder in ihre alte Lage zurückgefallen. Sie öffnete die Fenster, der Rauch zog ab, und Opa heizte den Ofen zukünftig nur noch mit dem dafür vorgesehenen Holz. Er nahm nur schweren Herzens von dem Gedanken Abschied, die Energie, die beim Verbrennen der Gartenabfälle frei wurde, nicht zu Heizzwecken zu verwenden.Meine Großeltern trugen manchmal ungezügelte Wortgefechte aus. Ich stand dann an der Wohnzimmertür und beobachtete die beiden durch die Glasscheibe. Es war wie im Theater. Sie stritten sich nicht, sie kabbelten sich. Das ist ein Unterschied. Für den Leser, der des westpreußischen Dialekts unkundig ist, sei bemerkt, daß kabbeln nicht ein gewöhnlicher Streit ist, sondern ein Gefecht mit Worten, mit langen Wortkaskaden. Meine beiden Großeltern mochten sich im Grunde ihrer Seele gerne. Wenn aber die Stunde des Kabbelns kam, [125] dann entluden sich die aufgestauten Unlustgefühle, die das enge Zusammenleben unter einem Dach mit sich bringt, mit einer unglaublichen Urgewalt. Manchmal begann das Kabbeln schon am Frühstückstisch mit einer provozierenden Bemerkung meiner Großmutter. Opa ließ sich nicht aus seiner stoischen Ruhe bringen. Das brachte Oma in Harnisch. Ein Wortschwall folgte, der so angelegt war, daß er Opa wie ein Pfeil treffen sollte. Dabei ging es meistens darum, daß Opa seinen Hof im noch jugendlichen Alter von achtundfünfzig Jahren verkauft und seitdem das Leben eines Privatiers geführt hatte. Das paßte nicht in ihre Vorstellungswelt von einem rechten westpreußischen Bauern.Opa zeigte Wirkung: "Du solltest Dich nicht als mein Richter aufspielen", entgegnete er. "Wenn ich meinen Hof nicht Deinem Adolf verkauft hätte, der schon immer hoch hinaus wollte, könntest Du Dich jetzt nicht so aufplustern." Meine Großmutter setzte einen noch gröberen Keil an. Sie klagte meinen Großvater des Fehlverhaltens in seiner Ehe und in der Erziehung seiner Kinder an. Sie seien in ständiger Angst vor dem Bruder meines Großvaters aufgewachsen, der geistesgestört in seinem Haus gelebt habe. Ihr liebes Kätchen, ihre Schwiegertochter, sei doch erst richtig aufgelebt, als sie das Elternhaus verlassen hatte. Und überhaupt sei es unverzeihlich, daß von vierzehn geborenen Kindern nur vier am Leben geblieben seien. Opa war jetzt schachmatt gesetzt. So, als wollte meine Großmutter ihren Triumph ganz auskosten, fügte sie hinzu, sie sei froh darüber, sich für ihren Adolf entschieden zu haben. Der sei ein tüchtiger Verwalter ihres Hofes gewesen. Wie sähe der wohl jetzt aus, wenn sie einen gewissen Gustav Huhse erhört hätte, der um sie geworben habe. So zog sich die Kabbelei manchmal über Stunden hin. Ich hatte hinter der Wohnzimmertür Dinge von Menschen erfahren, über die in der Familie nicht gesprochen wurde. Es war endlich etwas los in dem langweiligen, ländlichen Alltag meiner Jugend. |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|
![]() Volker J. Krüger, heim@thorn-wpr.de
Volker J. Krüger, heim@thorn-wpr.de
letzte Aktualisierung: 30.07.2004