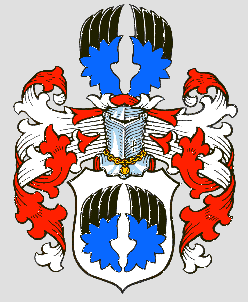
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Der alten Heimat treu |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
Im August einundsechzig war es soweit. Holländische, belgische und westdeutsche Automobilclubs veranstalteten eine Zielfahrt nach Warschau, der sich Hellmut Neumann und ich anschlossen. Nach einem viertägigen Aufenthalt in Warschau fuhren wir über Plonsk, Sierpz, Lipno nach Thorn. Die Straße war in einem ausgezeichneten Zustand. Zwischen Warschau und Thorn, auf einer Strecke von etwa zweihundertzwanzig Kilometern, begegneten wir etwa zehn Autos, aber ungezähl[351]ten Bauernwagen mit einem Pferd an einer Deichsel angespannt. Wir hätten sehr schnell fahren können, müßte man nicht jederzeit damit rechnen, daß eine der Kühe oder der unendlich vielen Gänse, die an den Straßenrändern weideten, plötzlich vor den Wagen läuft. Nach siebzehn Jahren näherten wir uns der Heimatstadt. Es ist ein seltsames Gefühl. Wie werden wir Thorn vorfinden? Es soll im Kriege nach den Berichten nicht zerstört worden sein. Ich erinnere mich an einen Lichtbildervortrag, bei dem der Redner ein buntes Diapositiv von der vertrauten Silhouette zeigte, die er von der Basarkempe aus aufgenommen hatte. Also wird sich gar nicht viel verändert haben, dachte ich. Wir hatten zwar einige Adressen von Polen, die heute noch dort wohnen; aber genügen diese Anknüpfungspunkte, um nicht in eine gänzlich fremde Stadt zu kommen? Fahr doch langsamer, Hellmut, sagte ich, da sind ja schon die ersten Häuser von Jakobsvorstadt, da der Schlachthof, und rechts muß die Katharinchenfabrik von Weeses liegen. Wir fuhren langsam in die Stadt hinein. Plötzlich sah man die Weichsel mit ihren beiden Brücken. Es war ein völlig unverändertes Bild. Nur enger und kleiner waren die Straßen, der Stadtbahnhof und die Häuser, als ich sie in Erinnerung hatte. Obwohl diese Gegend nie eine gute Visitenkarte von Thorn war, jetzt machten die Häuser und Straßen nicht nur hier, sondern auch nachher in der Innenstadt einen düsteren, schmutzigen Eindruck. Von meinen Spaziergängen mit Gerda hatte ich die Jakobsvorstadt in viel schönerer Erinnerung. Wir mußten uns zunächst um ein Hotel bemühen und fuhren über die Breite Straße in die Bäckerstraße. Der "Schwarze Adler", den wir von früher als erstes Haus am Platze kannten, hieß "Weißer Adler". Das sollte uns nicht stören. Hotel ist Hotel. Wir hielten an und wollten gerade aussteigen, als ich einen Mann aus einer Gaststätte herauskommen sah, der mir bekannt vorkam. Das ist doch Euer ehemaliger Gärtner, dessen Adresse Du hast? fragte ich Hellmut. Tatsächlich, er war es, doch wir zögerten einen Moment unschlüssig, [352] ob wir ihn ansprechen sollten. Aber dann stiegen wir aus dem Auto aus, gingen auf ihn zu und sagten, wer wir seien. Hätten wir den Überschwang dieser Begrüßung in aller Öffentlichkeit geahnt, wir wären weitergefahren und hätten uns an dem Mann unerkannt vorbeigedrückt. Wir konnten nicht im entferntesten erwarten, mit erhobener Stimme begrüßt und als gute, alte Bekannte stürmisch umarmt zu werden, während sich schnell eine große Menschenmenge ansammelte, die die Begrüßungszeremonie mit wiederholten Handküssen interessiert beobachtete. Wir dürften auf keinen Fall ein Hotelzimmer nehmen, sagte er, sondern sollten selbstverständlich in seinem Hause wohnen. Es war sehr schwer, diese Einladung auszuschlagen. Wir mußten doch wenigstens einwilligen, mit ihm zusammen nach Hause zu fahren und dort Abendbrot zu essen. Da im "Weißen Adler" kein Zimmer mehr frei war, fuhren wir mit unserem alten Bekannten zum Hotel "Polonia" gegenüber dem Stadttheater. Hier quartierten wir uns ein und fuhren dann zu einem ausgedehnten, reichhaltigen Abendbrot, zu dem wir eingeladen waren. Viele gemeinsame Erinnerungen wurden ausgetauscht. Die etwa siebzehnjährige Tochter, die unsere Unterhaltung mit zurückhaltendem Interesse verfolgt hatte, sprang plötzlich auf und lief aus dem Zimmer. Nach kurzer Zeit kam sie mit einer alten Zigarrenkiste voll vergilbter Fotos wieder. Wir fanden noch Aufnahmen von unseren Eltern und von einem großen Treffen des Landbundes Weichselgau in Wiesenburg. Die Bilder konnten wir mitnehmen. Die Frau unseres Bekannten gab uns ein großes Stück Schinken, Brot und Obst als Wegzehrung mit. Die Tochter fand immer noch etwas und kam dann strahlend angelaufen, um uns mit irgendeiner Kleinigkeit eine Freude zu machen. Nachdem uns die Familie Haus und Garten, einschließlich der Vorräte im Keller, voller Stolz gezeigt hatte, fuhren wir in das Hotel nach Thorn zurück. Am nächsten Vormittag unternahmen wir einen ausgedehnten Bummel durch die altvertrauten Straßen. Wie wenig hatte sich im Grunde verändert. Die Bürgersteige, auf denen wir so oft in unserer Schulzeit entlanggegangen waren, hatten noch die [353] gleiche Pflasterung wie früher: große, aneinandergereihte, quadratische Granitplatten, die an beiden Seiten mit kleinen Steinen eingefaßt sind. Außer in manchen Stadtteilen von Berlin habe ich diese Art von Bürgersteigen in ganz Europa nicht wieder gefunden. Wir spazierten, von niemandem erkannt, am Stadttheater vorbei und gingen die hohe Mauer am "Runden Turm" entlang, in dem mein Vater in Untersuchungshaft gesessen hatte. Dann zog es uns mit magischen Kräften in Richtung unserer Schule in der Bäckerstraße, in die wir beide von der Sexta bis zur Prima gegangen waren. Wir betraten, die innere Erregung voreinander verbergend, den Schulhof. "Es müssen wohl gerade Ferien sein", sagte Hellmut, "denn kein Mensch ist zu sehen." Wir gingen durch den Haupteingang, an dem dann gleich rechts die Wohnungstür von Herrn Wiedemann war, unseres gefürchteten und gleichzeitig geliebten Hausmeisters. Auch hier war alles unverändert. Nur ein anderer Name war an der Wohnungstür angebracht. Wir gingen die Treppe hinauf, gleich links warfen wir einen Blick in den Klassenraum unserer letzten drei Schuljahre. Seltsam, es roch sogar noch genauso wie früher, etwas verstaubt, nach feuchtem Mauerwerk und nach dem geölten Dielenfußboden. Noch immer war kein Mensch zu sehen. Wir öffneten vorsichtig die Tür gegenüber unserem Klassenraum und wollten gerade in das ehemalige Lehrerzimmer gehen, in dem wir vor dreiundzwanzig Jahren unser Abitur gemacht hatten, da trat uns ein Mann entgegen. Er stellte sich als der jetzige Hausmeister vor. Als wir ihm sagten, wer wir seien und warum wir die Schule ansehen möchten, beobachtete ich gespannt, wie er reagieren würde. Unsere Überraschung war groß, wie schon so häufig in Polen. Er nahm uns und unser Anliegen als gar nichts Besonderes auf, nicht feindselig, nicht einmal reserviert. "Bitte schön", sagte er nur, "sehen Sie sich ruhig alles an. Wir haben jetzt hier eine Vorbereitungsschule für das Studium an der Thorner Universität." Gemeinsam gingen wir wei[354]ter durch das ganze Gebäude bis in den ehemaligen Physiksaal. Ich weiß nicht, wie es sich ergeben hatte, aber als wir wieder hinausgingen, sprachen wir deutsch miteinander, und es zeigte sich, daß es besser ging als vorher mit unserem holprigen, zwanzig Jahre nicht mehr geübten polnisch. Jetzt begann mir der Aufenthalt in Thorn Spaß zu machen. War es der freundliche Hausmeister in unserer Schule, der in uns nur die Menschen und nicht die Feinde sah, war es das herrliche Wetter? Thorn zeigte jedenfalls heute ein freundliches Gesicht. Wir gingen auf den schon früher sehr schönen Platz vor der neuen Brücke. Da die alte, verräucherte Gasanstalt abgerissen war und dieses Gelände bis hin zum "Schiefen Turm" und zur Weichsel in den mit üppig blühenden Rabatten und weiten Rasenflächen großzügig gestalteten Platz einbezogen ist, machte hier alles einen ansprechenderen Eindruck als je zuvor. Thorn hatte wieder ausgedehnte Grünanlagen. In der Bromberger Vorstadt soll eine dreihundertfünfzig Hektar große Park- und Rasenfläche sein, sagte man uns. Erfreut konnten wir feststellen, wieviel die Stadt für die Pflege dieser großen Grünanlagen aufwendet. Wir gingen die Copernicusstraße entlang zurück in die Altstadt, vorbei an der ehemaligen Ausspannung von Netz, wo an den Markttagen immer Hochbetrieb war, vorbei an dem Lebensmittelgeschäft des ehemaligen deutschen "Hausfrauenvereins", in dessen Vorstand meine Mutter war. Noch immer ist nebenan das Friseurgeschäft, in dem ich so oft meine Haare schneiden ließ. "In Verlängerung der Heiligen-Geist-Straße ist die Altstädtische Kirche, in der ich durch Pfarrer Heuer konfirmiert worden bin." Wir betraten die Kirche durch einen Seiteneingang. Die Orgel und der Altar waren unverändert, nur die große Wandfreske des "Thorner Blutgerichts" fehlte. Wie in den katholischen Kirchen üblich, war ein reges Kommen und Gehen durch das offenstehende Hauptportal. Sehr viele Menschen waren an diesem Vormittag in der Kirche. Ist es nur Tradition, nach den Einkäufen die Tasche in der Hand, in die Kirche zu gehen, die nun [355] erst recht auch in einer kommunistischen Volksrepublik gepflegt wird? Vielleicht ist es aber auch ein bewußtes Christentum, das mir die hier versammelten Menschen nähergebracht hätte. Man konnte den Kirchgängerinnen nicht ansehen, was in ihnen vorging. Ob wohl ihr Glaube, der sie früher als Polen noch schärfer von uns evangelischen Deutschen trennte, sie uns jetzt in einer kommunistischen Umwelt näherbringt? Mit dieser unbeantworteten Frage ging ich hinaus auf den Altstädtischen Markt, am Rathaus, Artushof, Copernicusdenkmal vorbei. Dort schräg gegenüber war früher das Textilhaus "Leiser", wo meine Mutter immer eingekauft hatte. Wir schlenderten wie früher die Breitestraße entlang. Hier war das Kaffeegeschäft von Templin, dort Grunert, hier war Kling, wo wir unsere Schülermützen machen ließen. In Westphals Geschäft war immer noch eine Buchhandlung. Wir gingen dann zu einer uns von früher her bekannten Familie. Wie lebt der polnische Arbeiter im sozialistischen Staat? Hier werden wir es sehen und erfahren. Das Haus in der Altstadt, etwa um die Jahrhundertwende erbaut, sah genauso aus wie alle anderen, schmutzig, grau, ungepflegt. Die Treppen waren ausgetreten, als wenn sie über ein halbes Jahrhundert nicht erneuert worden sind. Von dem Geländer und an den Wänden des Treppenhauses war auch der allerletzte Farbrest abgebröckelt. In der zweiten Etage fanden wir den gesuchten Namen. Obwohl der Bekannte Facharbeiter und seine Frau berufstätig ist, war die Wohnung sehr klein und ärmlich eingerichtet. Man erwartete uns bereits mit einem Frühstück, das in seiner Reichhaltigkeit gewiß ein großes Opfer für die Familie war. Wir unterhielten uns sehr offen. Da die Ehefrau nicht deutsch sprach, schwirrten deutsche und polnische Sätze durcheinander. Uns interessierten die Lebensverhältnisse in Polen, und wir wurden nach den gemeinsamen Bekannten ausgefragt, die jetzt in der Bundesrepublik Deutschland leben. Nach den Berichten muß die Unterdrückung zur Zeit, als noch die Stalinisten in Polen regierten, unerträglich gewesen sein. Die Menschen, die hier keine ande[356]ren Vergleichsmaßstäbe für den Lebensstandard und für die staatsbürgerlichen Freiheiten haben, sehen nur den Fortschritt, den sie seit dem Oktoberaufstand im Jahre sechsundfünfzig gemacht hatten. Das Einkommen des Ehepaares reichte so eben für eine bescheidene Wohnung und den Lebensunterhalt einer nur dreiköpfigen Familie. Man richtete sich so gut es geht in dem herrschenden Regime ein, dessen Verdienst anerkannt wurde, für den Ostblock ungewöhnliche bürgerliche Freiheiten erkämpft zu haben. Diese Tendenz war besonders bei einem außerdem noch anwesenden jungen Mann spürbar. Er berichtete von einer großen Reise, die er kürzlich mit seiner Schulklasse in die Sowjetunion gemacht hatte, und zeigte Bilder aus Moskau und Leningrad. Er war genauso stolz auf seine Erlebnisse, wie es ein Schüler bei uns wäre, der gerade eine Reise nach Rom oder Paris hinter sich hat. Am ersten Vormittag unseres Aufenthalts in Thorn ging ich dann noch zum Grab meines Vaters auf dem Altstädtischen Friedhof. Es ist dort zusammen mit den Gräbern vieler Opfer der ersten Septembertage des Jahres neununddreißig. Der evangelische Teil des Friedhofs war verwahrlost, im Gegensatz zu dem gut gepflegten katholischen Teil. Der Bereich, in dem meiner Erinnerung nach das Massengrab liegen mußte, nach dem ich suchte, war unter dichtem, seit Kriegsende ungehindert wucherndem Buschwerk verborgen. Ich konnte mich nicht mehr orientieren und fragte die Frau des Friedhofsgärtners nach der Grabstelle der Deutschen vom September neununddreißig. Sie führte mich, selbst unsicher, an eine Stelle, wo ich eine halbe Stunde lang im dichten, urwaldähnlichen Gebüsch vergeblich gesucht hatte. Hier war eine Rasenfläche, die noch von einer halb umgebrochenen Lebensbaumhecke umgeben war. Dort unter der Grasnarbe, dachte ich, liegen also die Männer, die den gigantischen Reigen unschuldiger Opfer des Zweiten Weltkriegs eröffnet hatten. Ein junges Paar, das sich gerade diese ruhige Stelle für ein vormittägliches Rendezvous ausgesucht hatte, war von meinem Kommen überrascht worden. Ich sagte dem noch jungen [357] Mann den Grund, warum ich. diese so harmlos daliegende, kleine Rasenfläche aufsuche. Er konnte seine Rührung kaum verbergen. Als ich ihn dann fragte, was er über die Verwahrlosung des evangelischen Teiles des Friedhofs denke, sagte er gänzlich unbekümmert: "Ich persönlich lehne so etwas ab. Die Stadt oder der Staat müßten Mittel für die Instandsetzung der Friedhöfe bereitstellen. Aber fragt man diejenigen, die wie wir denken? In den Zeitungen steht, wir könnten frei unsere Meinung sagen. Das ist aber nur Fassade." Wie ist diese Äußerung zu verstehen? Vielleicht wollte der junge Pole mir nur etwas Verbindliches sagen. Mir wäre es tröstlicher gewesen, wenn seine Worte Ausdruck eines gesunden Empfindens der polnischen Jugend gewesen wären, daß trotz allem, was vorgefallen ist, ein neuer Anfang möglich wäre. In der Friedhofsgärtnerei kaufte ich einen Strauß bunter Sommerblumen und stellte ihn in einem Wasserglas auf die Stelle, wo ich das Grab meines Vaters vermutete. Die Blumen galten aber auch allen anderen, die auf dem Marsch nach Warschau unter den Schüssen und Gewehrkolbenhieben aufgehetzter Jugendlicher zusammengebrochen waren und hier ihre letzte Ruhe gefunden hatten. Als ich am nächsten Tag noch einmal die Grabstelle aufsuchte, war der bunte Blumenstrauß verschwunden. Am Nachmittag fuhren wir in die Thorner Weichselniederung. Von Thorn bis zu meinem Elternhaus war es mit dem Einspänner eine Fahrstrecke von fast einer Stunde. Im Auto dauerte es jetzt nur einen Augenblick, und schon lag der viel größer gewordene Wald von Wiesenburg vor uns, der sofort hinter der Stelle beginnt, wo die Schienen der Holzhafenbahn die Chaussee überqueren. Wir bogen hier links ab und durchfuhren einen schmalen Waldstreifen. Unser Auto holperte noch über einige Baumwurzeln, dann hielten wir an. Vor uns lag die unveränderte Landschaft der Niederung, zum Greifen nahe und doch so unendlich fern. Die Linden der Unterstraße waren inzwischen kaum größer geworden. Im Dunst der heißen Mittagssonne sah man die Höfe fast unverändert [358] liegen. Einen eigenartigen Reiz hat die Landschaft, der es vom Weichseldamm geborgen gleichgültig zu sein schien, von welchen Menschen sie bewohnt wird. Langsam fuhren wir am Waldrand entlang bis zum Tor, das auf Hellmuts ehemaligen Gutshof führt. Kein Mensch war zu sehen. Wir schlugen zunächst nicht den Weg zum Haus, sondern zur Familiengrabstätte der Neumanns ein, die im Park liegt. Das ausgedehnte Gelände, das Hellmuts Mutter früher einmal mit uralten Bäumen, Blumenbeeten, Teichen und Wasserspielen liebevoll zu einem Parkkleinod gestaltet hatte, war verwildert. Die Grabstätte war verwüstet. Auf dem Grabstein von Hellmuts Vater, der umgestürzt dalag, war noch zu lesen: "Er starb für die Wiedergewinnung der Heimat". Nach dem Rundgang durch den ehemaligen Park näherten wir uns dem Gutshaus. Die hier beschäftigten Bauarbeiter nahmen kaum Notiz von uns. Wie es sich in einem ausführlichen Gespräch mit dem Direktor des heute als Staatsbetrieb bewirtschafteten Gutes herausstellte, werde das Haus gegenwärtig mit Hilfe erheblicher staatlicher Mittel im alten Stil restauriert. Auch die Wirtschaftsgebäude seien neu aufgebaut worden, nachdem sie völlig heruntergekommen von der russischen Besatzung geräumt worden waren. Der landwirtschaftliche Betrieb werde nach Methoden der Vorkriegszeit bewirtschaftet. Neben zwei Schleppern seien auf einhundertfünfundsechzig Hektar etwa dreißig Pferde vorhanden. Die über einhundert Kühe werden von Frauen mit der Hand gemolken. Die Getreideerträge seien mit zwanzig bis fündundzwanzig Doppelzentnern je Hektar noch nicht so hoch wie sie vor dem Kriege einmal waren. Auf den Feldern werde das Getreide gerade in große Diemen zusammengefahren, die dann im Winter gedroschen werden. Der Betriebsleiter gab uns bereitwillig Auskunft über Wirtschaftsweisen und Arbeitsverhältnisse. Nach seiner eigenen fachlichen Ausbildung befragt, sagte er: "Bei uns erhalten jetzt nur Fachleute solche Positionen, wie ich sie einnehme. Ich war früher Verwalter auf verschiedenen Gütern und habe Erfahrungen in meinem Beruf. Obwohl ich jetzt schon [359] viel geschafft habe und große Summen zum Wiederaufbau des Betriebes investiert habe, könnte noch viel mehr geleistet werden, wenn ich hier Eigentümer wäre. Ich kann mir ein genaues Bild über die frühere Wirtschaftsweise machen, der Betrieb ist rationell geführt worden." Wir erzählten, wie sich die Erträge und die Mechanisierung der Landwirtschaft in der Bundesrepublik nach dem Kriege entwickelt haben. Über das rein Fachliche sind wir in diesem Gespräch nicht hinausgekommen. So kühl und korrekt wie der Empfang war auch der Abschied. Von unseren Landarbeitern in Altthorn wohnte der alte Beszczynski als Rentner in einem der Wiesenburger Häuser. Er konnte es gar nicht fassen, als wir plötzlich vor ihm standen. So reserviert der Betriebsleiter im Gutshaus war, so herzlich war das Wiedersehen mit dem ehemaligen Deputatsarbeiter. Als ich ihm sagte, wir wollten heute noch weiter nach Altthorn fahren, machte er ein sorgenvolles Gesicht. "Dort sieht es böse aus. Man hat Ihren Betrieb in acht Kleinbauernstellen aufgeteilt. Fahren Sie lieber gar nicht hin. Ich kann diese Armut und die verfallenen Gebäude nicht sehen. Deswegen bin ich schon lange nicht mehr dort gewesen." Dann beschrieb er mein Elternhaus und die Wirtschaftsgebäude, von denen zwei Scheunen und der ehemalige Maschinenschuppen abgerissen seien. In dieser Weise vorbereitet fuhren wir weiter. An der Chaussee, dort wo der Weg auf unseren Hof links abgeht, stand früher ein altes, strohgedecktes Landarbeiterhaus. Es war abgebrannt. Das Mauerwerk war noch gut zu erkennen. Unmittelbar neben dieser Ruine hatte ein ostpolnischer Kleinbauer sein neues Anwesen aufgebaut. Das niedrige Wohnhaus und eine kleine Scheune waren aus Lehm gebaut und weiß angekalkt. Wir fuhren unseren Feldweg entlang, der auf den Hof führt, zunächst durch die sogenannten Bergwiesen, auf denen einige Kühe fremdartiger Rasse weideten. Auf den sich anschließenden Feldern waren einige Menschen bei der Getreideernte. Wir fuhren an dem zweiten Landarbeiterhaus [360] vorbei, in dem früher die Familie Beszczynski und die Schweizerfamilie wohnten. Das Haus wird weiterhin bewohnt, aber daneben standen eine Scheune und ein kleiner Schuppen, was darauf hindeutete, daß hier ein zweiter kleiner Bauernhof entstanden war. Wir folgten der leichten Rechtskurze des Weges und fuhren auf den Hofplatz. Ich stieg aus und sah mich um. Auf der Stelle, wo früher die große Hofscheune stand, war ein kleiner, halb so großer Holzschuppen errichtet worden. Andere Gebäude fehlten ganz. Mein Elternhaus stand kahl da und sah schwer verwundet auf mich herunter. Vom großen Ahornbaum, der es vor den kalten Ostwinden geschützt hatte, war nichts mehr zu sehen. Auch von dem Garten, dessen gepflegte Kieswege früher jeden Sonnabend geharkt worden sind, waren nur noch einige Bäume und Büsche zu finden. Von der Syringahecke meiner Mutter war keine Spur mehr vorhanden. Die Fensterrahmen des Hauses hingen schief in den Angeln, andere waren ganz herausgenommen worden. Die große Dielentür, die auf den Balkon oberhalb unserer Veranda hinausführte, war teilweise mit Brettern vernagelt. Die Haustür und die ehemals weiß gestrichenen Fensterrahmen hatten einen graugrünen Farbton angenommen. Das Haus machte mehr den Eindruck einer langsam verfallenden Ruine. Als ich es betrat, kam mir eine alte Frau mit schwarzem Kopftuch entgegen. Ich stellte mich vor und sagte, daß ich mein Geburtshaus besichtigen möchte. Die kleine, verhärmte Person brach in Tränen aus und sagte mit weinerlicher Stimme, daß sie sich hier niemals heimisch fühlen würde und sie lieber heute als morgen in ihre ostpolnische Heimat hinter dem Bug zurückkehren möchte, wenn sie es nur könnte. Sie würde, fügte sie mit Bitterkeit hinzu, barfuß in ihr Heimatdorf zurückgehen. Im Schlafzimmer meiner Eltern erkannte ich noch einen Tisch und in einem anderen Zimmer einen Schrank. Sonst konnte ich kein bekanntes Möbelstück oder Bild entdecken. Im ehemaligen Gästezimmer hatte die alte Frau ihr sehr ärmlich möbliertes Domizil aufgeschlagen. In einer Ecke lag ein kleiner Haufen [361] gelber Pflaumen. Sie suchte behende eine Tüte, füllte sie und sagte: "Das nehmen Sie bitte für Ihre Mutter mit, die doch genauso alt ist wie ich." Wie es sich aus dieser und ähnlichen Äußerungen heraushören ließ, war sie, obwohl erst 1946 aus Ostpolen zwangsweise umgesiedelt, genau über meine Familie orientiert. Wie kann sich nur ein Haus verändern? Wir gingen in das neben dem Elternschlafzimmer liegende Zimmer meiner Schwestern. In diesem Raum lebte ein Ehepaar mit einem Kind. Hier schliefen, kochten und aßen sie. Hier spielte das kleine Kind und wusch die Frau ihre Wäsche. Ihr Mann arbeite in Thorn, sagte sie. Das ehemalige Eßzimmer war verschlossen. "Wir können hier nicht hinein", sagte die alte Frau, "die Familie, die hier wohnt, ist auf dem Felde." Drei der acht Zwergbetriebe wurden von unserem Hof aus bewirtschaftet. Nicht nur das Haus, auch die Wirtschaftsgebäude waren in drei Teile aufgeteilt worden. Ich wollte weiter durch das Haus gehen. Wo früher eine Tür war, stand ich plötzlich vor einer unverputzten Mauer. Eine der drei Familien lebte in Streit mit den anderen Hausbewohnern. Kurzerhand hatte man eines Tages den Teil des Hauses zugemauert, in dem die unverträgliche Familie lebte. Über den Hof ist ein zwei Meter hoher, fester Lattenzaun errichtet worden. Um in den anderen Teil des Hauses zu gelangen, mußten wir bis zum ehemaligen Kuhstall gehen. Auch dieses Gebäude war durch eine Mauer in zwei Teile aufgeteilt worden, so daß uns auch hier der Weg versperrt war. Zum Glück hatte der Kuhstall eine massive Decke, ich erinnere mich noch, als mein Vater sie bauen ließ, denn sonst ständen wir in dem Gebäude unter freiem Himmel. Das Dach war eingebrochen, und auf der Massivdecke waren inzwischen allerlei Büsche gewachsen, deren Zweige bereits über den Dachfirst hinausragten. Wir gingen um den Kuhstall herum und mußten einen großen Umweg machen, bis wir durch einen Stacheldrahtzaun kriechend am ehemaligen Kücheneingang meines Elternhauses angelangt waren. Auf unser Rufen hin kam eine Frau aus dem Keller die Treppe [362] herauf. Als wir sie begrüßten, war sie überrascht und erschrocken. Sie hätte es sehr gern gesehen, wenn wir gleich wieder gegangen wären. Langsam wurde sie dann jedoch freundlicher, zeigte uns ihre Wohnung und erzählte, nicht ohne Mitgefühl, von dem Schicksal der wenigen Deutschen, die fünfundvierzig nicht geflohen waren. Es seien alles alte Menschen gewesen, die dann nach und nach gestorben sind. Eine alte Frau habe sich in dem Unterkanal ertränkt. Ich wußte, daß dies Tante Olga, die Schwester meiner Mutter, war. Wir wollten die Namen der acht Familien wissen, die jetzt die kleinen Höfe bewirtschaften. Die Frau zählte sie auf und schilderte wortreich, woher sie gekommen sind. Alle seien aus Ostpolen, dem Gebiet, das an die Sowjetunion abgetreten wurde. Inzwischen hatte sich die Nachricht von unserer Ankunft verbreitet. Als wir aus dem Haus hinaustraten, sahen wir, daß einige Männer und Frauen vom Felde herbeigeeilt waren. Kinder starrten uns an, als ob wir von einem anderen Stern gekommen wären. Es war kein Groll zwischen ihnen und uns. Ich erzählte ihnen einige Geschichten des Hofes, vom Weichselhochwasser im Jahre einundsiebzig, von dem Birnbaum im Garten, der die Eisschollen vom Haus abgewehrt hatte, und weitere wahre Begebenheiten, die ich von meinen Eltern und vor allen Dingen von meiner Großmutter Hermine wußte. Habt Ihr hier eine Produktionsgenossenschaft? wollte ich wissen. "Ja, wir wurden gezwungen, eine Kolchose zu gründen. Dort steht sogar unser ehemaliger Vorsitzender", antwortete einer der Bauern. Alle wendeten sich um und sahen auf einen düsteren, im Hintergrund stehenden Mann, der breit zu grinsen begann und nicht den intelligentesten Eindruck machte. Sofort als Gomulka im Oktober sechsundfünfzig die Zügel etwas lockerte, sei die Kolchose über Nacht aufgelöst worden. Es stellte sich im weiteren Gespräch heraus, daß die Bauern zwar ihr Land selbständig bewirtschaften, aber noch nicht Eigentümer der kleinen Höfe geworden sind. Warum laßt Ihr die Gebäude so verfallen?, fragte ich den [363] aufgeschlossensten Mann, der vor mir stand. Ihr könntet doch die Steine und das Baumaterial von den Gebäuden verwenden, die nicht mehr benutzt werden, und die anderen damit ausbessern. Die Gesichter der Umstehenden wurden verlegen, und zögernd kam die Antwort: "Die Steine verwenden wir nicht, denn es sind deutsche Steine." "Und wenn Sie mich fragen", sagte. der Mann vor mir, "ich will den Boden hier gar nicht kaufen, auch wenn ich es könnte, denn es ist deutscher Boden. Wir rechnen damit, daß Sie noch einmal wieder hierher zurückkommen werden." Was soll man von einer solchen Antwort halten? Ist es eine Ausrede, ist es ein gesundes bäuerliches Empfinden für Mein und Dein, oder was steckt sonst dahinter?, dachte ich. Dann fragte ich die versammelten Menschen, die einen immer engeren Halbkreis um uns bildeten, warum sie das Entwässerungssystem der Niederung verfallen lassen. Der untere und der obere Kanal, die Seitengräben und die Drainagen sind doch vollständig zugewachsen. "Das stimmt", war die Antwort einer Frau, die ein Baby auf dem Arm trug. "Es ist doch sinnlos, auf den nassen Ackerstücken etwas auszusäen. Auch in Ihrer Obstplantage, die von Ihrem Vater angelegt worden ist, ernten wir sehr wenig, da der Boden dort viel zu kalt ist." Seit fünfundvierzig sind die Gräben nicht mehr entkrautet und die Drainage nicht mehr erneuert worden. Die Böden der Niederung werden von Jahr zu Jahr nasser, saurer und kälter werden, sagte ich. Der Abschied war herzlich, und alle winkten, bis wir auf die Unterstraße rechts in Richtung der Gursker Kirche einbogen. Jetzt fuhren wir den Weg entlang, den wir beide früher unzählige Male zur Volksschule und zur Kirche entlang gefahren oder gegangen waren. Es war deprimierend zu sehen, wie die ehemals sauberen Höfe langsam verfielen. Über den Kirchweg fuhren wir zurück zur Chaussee nach Thorn. Auf halbem Wege, an der Einfahrt zu einem der beiden Gärtnereibetriebe von Max Hentschel, stand ein Polizist, der [364] unsere Papiere sehen wollte. Obwohl sie in Ordnung waren und er nichts zu beanstanden hatte, wurden wir mit der Begründung verhaftet, wir seien von der Bevölkerung angezeigt worden, weil wir staatliche Objekte fotografiert hätten. Wir sollten uns am nächsten Morgen um neun Uhr in Thorn bei der Miliz melden. Wir taten es nach einer sehr unruhigen Nacht, wurden zwei oder drei Stunden verhört und dann entlassen, nachdem wir alle belichteten Filme abgegeben hatten. Noch am gleichen Vormittag fuhren wir in Richtung Frankfurt an der Oder von Thorn ab. In Bromberg hatten wir beim Mittagessen Gelegenheit, mit verschiedenen Polen über die Lage zu sprechen. Allgemein wurde anerkannt, daß ein besonderes Verhältnis zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk angestrebt werden sollte, ja, es müsse ein neuer Anfang versucht werden, war die einhellige Meinung. Wir stimmten mit unseren Gesprächspartnern auch darin überein, daß es nur durch persönliche Kontakte möglich sei, über die tiefe Kluft, die die jüngste Geschichte zwischen Deutschen und Polen aufgerissen hat, eine Brücke von Mensch zu Mensch zu schlagen. Aber viele Schwierigkeiten würden sich diesem allzu natürlichen Bestreben beider Seiten entgegenstellen. Man erzählte uns hinter der vorgehaltenen Hand, daß sich irgend etwas zwischen Ost und West abspiele. Die Wälder seien voll von rüssischem Militär, tief gestaffelt von Berlin bis nach Ostpreußen hinein. Es war kurz vor dem Mauerbau. Wir ahnten damals den Anlaß für die Vorsorgemaßnahmen der Roten Armee nicht. Ein intelligenter polnischer Jurist fragte mich, nachdem wir uns über die Notwendigkeit der deutsch-polnischen Aussöhnung verständigt hatten, warum die Bundesrepublik Deutschland so stark rüste und einen Friedensvertrag ablehne. Der Kern dieser Frage zielte auf den wiedererstandenen deutschen Militarismus und Revanchismus, die die politische Propaganda in Polen ebenso wie in den anderen Ostblockländern den Menschen täglich einhämmert. Ich erläuterte ihm, daß die deutsche Frage bis zu einem Friedensvertrag [365] offen bleiben müsse. Deutschland sei in vier Gebiete geteilt. Die Bundesrepublik sei nur ein Teilstaat und könne nicht für das Deutsche Reich handeln. "Ich persönlich habe Verständnis für Ihren Standpunkt", sagte er. "Sie streben einen wiedervereinigten Staat an. Aber warum sprechen Sie von einer Teilung Deutschlands in vier Gebiete? Es sind nach dem Kriege auf deutschem Boden nur zwei Staaten entstanden, und wenn Sie Berlin noch dazu rechnen, dann sind es drei." Als ich ihm entgegnete, er habe in seiner Aufzählung die deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie nicht erwähnt, sie lägen auch in den Grenzen von 1937, schlug sich mein Gesprächspartner mit der Hand auf das Knie und sagte: "Ach, das habe ich ganz vergessen." Als ich ihn darauf aufmerksam machte, daß er aus der Geschichte seines Volkes wissen müsse, wie bitter eine Teilung sei und daß die Polen sich über einhundertfünfzig Jahre nicht mit dem gleichen Unrecht abgefunden haben, stimmte er zu, fragte aber, wie wir uns eine Änderung der bestehenden Verhältnisse ohne Krieg dächten. In Frankfurt an der Oder fuhren wir über die Grenze der Deutschen Demokratischen Republik und von hier die schnurgerade Autobahn bis nach Helmstedt. Auf Hellmuts plötzliche Frage, ob wir jetzt eigentlich nach Hause oder von Zuhause kämen, sagte ich, ohne zu überlegen, wir fahren nach Hause und zwar auf dem schnellsten Wege. Rückblickend fragte ich mich, ob meine Geschwister recht hatten, die vor dem Wiedersehen mit unserem Geburtshaus, mit der Thorner Niederung, mit unserer Heimatstadt gewarnt hatten. Ich war mit gemischten Gefühlen zurückgekommen und sagte mir, wo du geboren worden, wo du aufgewachsen bist, wo du der rechtmäßige Erbe deiner Väter warst, da ist deine Heimat. Sie kann dir keine Macht der Welt nehmen, und mag sie noch so despotisch sein. Deine geistige Heimat ist dort, wo du jetzt lebst, weil du als frei geborener Mensch dort mit deiner Familie frei atmen kannst. Du bist aber nicht glücklich und im Grunde verzweifelt zurückgekommen, weil du nicht in deiner Heimat le[366]ben darfst, wo so viele Polen als Geiseln des sowjetischen Systems ohne Hoffnung auf Änderung ihrer Lage leben müssen. Das waren die Gedanken, die mich auf der Rückfahrt nach Hannover bewegten. Nach meinen Berichten von meinen Empfindungen und Erlebnissen in Thorn dachten wir im Kreis der Großfamilie darüber nach, was Heimat dem einzelnen bedeutet. Es ist eine Vielzahl von Gefühlen, die dieses viel strapazierte Wort auslöst. Wir hatten uns in unseren Häusern, in unserer neuen Umwelt eingelebt. Wir waren von vertrauten Menschen, die sich in unserer Sprache mitteilen, von unseren im Westen geborenen Kindern, von unseren Freunden und Vorgesetzten in unseren Betrieben und Dienststellen umgeben. Wir hatten in zähem Selbstbehauptungswillen auch die Anerkennung unserer Leistungen errungen. Dies wog mehr als die Erinnerungen, in denen sich unsere alte Heimat immer mehr zu einer heilen Welt verklärt hatte. Es sind nicht die herunter gewirtschafteten Betriebe, die zerstörten Gebäude, der lieblose Umgang der jetzigen Bewohner mit unserem Elternhaus, die eingeebneten Friedhöfe, die umgestürzten Grabsteine unserer Vorfahren, die in mir das Gefühl, in der Heimat zu sein, gar nicht aufkommen gelassen haben. Nein, vor allem fehlten mir die vertrauten Menschen meiner Kindheit und die im Westen lebende Familie. Heimat, so waren wir uns einig, ist nicht ein geographischer Standort, eine Landschaft, ein Dorf, eine Stadt, in der wir uns zufällig aus beruflichen Gründen aufhalten. Sie wird dazu, wenn wir uns durch unsere Tätigkeit, durch unser Streben, durch die Gesamtheit unseres Erlebens mit ihr identifizieren. Alles andere ist Sentimentalität, Wiedererweckung einmal gehabter, inzwischen gestorbener Gefühle. Das ist die eine Seite der Schlußfolgerungen aus unseren Gesprächen im Familienkreis. Die andere Seite: Keine Macht der Welt wird uns unsere Liebe zu Thorn, zu Altthorn, zu unserem Elternhaus, zur wunderschönen Niederung nehmen können. Wahre Liebe will nicht besitzen, sie kann auch lassen. Es tut weh, wenn das Objekt unserer Liebe von den neuen Be [367]sitzern lieblos behandelt wird. Liebe und Leid sind Geschwister. |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|