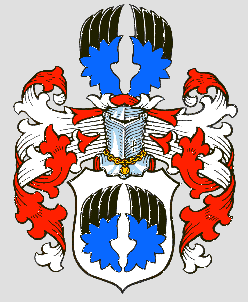
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Amerikanisches Reisetagebuch |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
[336]Erst nach der Studienreise durch die Vereinigten Staaten befaßte ich mich mit Alexis de Tocqueville. Ich begann durch dessen Werk "Demokratie in Amerika"(20), die USA besser zu begreifen, als es mir während der Reise gelungen war. Obwohl das berühmte Buch des Franzosen vor mehr als einhundert Jahren geschrieben wurde, fand ich in ihm bestätigt und erklärt, was ich gesehen hatte. Tocqueville hat recht, wenn er schreibt, daß sich außerhalb der Mehrheit in der amerikanischen Demokratie nichts behaupten könne. Sie sei angloamerikanisch dominiert. Von ihrer Allgewalt gehe eine furchtbare Bedrohung der Freiheit aus. Ich hatte es gesehen, wie die deutschstämmigen Bürger unter der Diktatur der angelsächsischen Mehrheit litten, und trotz gleicher Bürgerrechte bis auf wenige Ausnahmen bereits die erste dort geborene Generation ihre Muttersprache, ihre Sitten und Gebräuche verleugnete. Eine Ausnahme von dieser Regel bildeten nur die deutschen Auswanderer, die sich in geschlossenen Gruppen angesiedelt hatten und dadurch ihre ethnische Eigenart und ihre Sprache über mehrere Generationen hinweg bewahren konnten. Tocqueville hatte bei seinem Amerikaaufenthalt festgestellt, daß unter der Herrschaft der von der Mehrheit beschlossenen Gesetze die Geistesfreiheit ausgetilgt werden könnte. Der menschliche Geist könne sich eng an den Mehrheitswillen ketten lassen. So lasse die amerikanische Demokratie Bürger nicht nur ihre Ahnen vergessen, sie entfremde ihnen auch ihre Nachkommen. Bei diesen Aussagen des französischen Adligen mußte ich an die deutsche Frau denken, die einen amerikanischen Besatzungesoldaten geheiratet hatte und tränenüberströmt sagte, als sie uns als ihre Landsleute erkannt hatte, wie unglücklich und vereinsamt sie sich in ihrer amerikanischen Umwelt fühle. Die Tendenz zu einer vom Individualismus erzwungenen Apathie werde durch eine Gegenbewegung in der nordamerikanischen Gesellschaft durchkreuzt. Tocqueville sieht, wie sich im Föderalismus, in der Dezentralisation, in der Selbstverwaltung [337] der Wirtschaft und der Gemeinden, in Verbänden, Vereinen und in den Sitten des Volkes vor allem diese Gegenkräfte formieren. Das stärkste Bollwerk gegen Individualismus und Apathie sei aber die starke Stellung der Religion. Sie leiste den Vereinigten Staaten nur darum so große Dienste, weil sie von den Regierungen strikt getrennt sei. Die Kirchen mischten sich niemals unmittelbar in die Belange der Politik ein. Allein die Seelen seien ihre Sache, der Staatsbürger gehe sie nichts an. Auch der amerikanische Katholizismus habe sich der demokratischen Staatsidee angepaßt. Der Despotismus komme, schreibt der Franzose, ohne Glauben aus, die Freiheit nicht. Trotz aller kritischen Anmerkungen sagt Tocqueville der amerikanischen Demokratie eine große Zukunft voraus. "Man kann sich nicht verhehlen, daß die angloamerikanische Rasse in der Neuen Welt ein ungeheures Übergewicht über die anderen europäischen Rassen erlangt hat." Die zweite Rasse, der er einen ebenso großen Machtzuwachs voraussagt, ist die slawische unter Führung der Russen. "Der eine hat als Mittel des Handelns die Freiheit, der andere die Knechtschaft. Ihr Ursprung ist verschieden wie ihre Wege, und doch scheint jeder von ihnen nach einem geheimen Plan der Vorsehung berufen, eines Tages in seinen Händen die Geschicke der halben Welt zu halten." Angeregt durch die kluge Analyse von Tocqueville nahm ich mein amerikanisches Reisetagebuch mit in unseren Urlaub, den wir diesmal am Bodensee verlebten. Wenn die Kinder abends eingeschlafen waren, setzte ich mich an den Küchentisch unserer Ferienwohnung und las. New York, den 23. September 1953 Ein Verhältnis zu New York zu finden, erscheint mir aussichtslos. Die Höhe der Wolkenkratzer von Manhattan, das leben auf den Straßen, die Lichtreklame, alles spielt sich auf einer Wellenlänge ab, die meiner nicht entspricht. Mir tun die Menschen leid, die von diesem Moloch verschlungen werden. "Wer zählt die Völker, kennt die Namen" in diesem Babel mit großen Höhen an Kultur, Reichtum und Schönheit dicht neben tiefen Abgründen von Armut, Verfall, Kriminalität und Dreck. [338]Washington, den 25. September 1953 Ganz im Gegensatz zu New York fühle ich mich in Washington sofort geborgen und frei. Eine großartige Stadt mit viel Rasen, Bäumen und breiten, gut geplanten Alleen und Plätzen. Die Architektur orientiert sich an der klassischen Antike. Sie wirkt auf mich mit ihrer unaufdringlichen Ästhetik, obwohl auch hier die Dimensionen groß sind. Sie überschreiten jedoch nicht ein menschliches Maß. Charakteristisch für einen deutschen Auswanderer, der seine Herkunft nicht verleugnet, ist das Leben und die Arbeit von Herrn Schiefler, des Direktors unseres Hotels in Washington. Er hat sich mit Fleiß und Können nicht nur eine gute Position geschaffen, sondern tritt als bewußter Amerikaner, der hinter seinem Schreibtischsessel den Union Jack hängen hat, für die Verständigung mit Deutschland und für amerikanische Hilfe beim Wiederaufbau ein. Besonders auf kulturellem Gebiet vertritt er als aktiver Sänger Deutschland und wirbt so für seine Heimat. Er spricht fließend deutsch, trotz dreißigjährigem Aufenthalt in Amerika; doch manche Redewendungen sind schon amerikanisiert. Er plaudert verbindlich und gewinnend über seine Bemühungen, mit Hilfe des deutschfreundlichen Leibarztes Einfluß auf Truman zu gewinnen. "Wie konntet Ihr nach dem Eintritt der USA in den Krieg glauben, gegen dieses mächtige Land durchstehen zu können? Ja. unausgeschöpft sind die Reserven dieses Landes. Fünfhundert Millionen Menschen könnten hier bequem leben. Es ist ein wunderbares Land, ein Bollwerk der Freiheit. Obwohl ich Republikaner bin, habe ich doch mit der Familie Truman verkehrt." Die Tochter des ehemaligen Präsidenten sei mit seiner Tochter befreundet, und sie hätten im Hause Truman gemeinsam musiziert. Ein guter amerikanischer Staatsbürger, dieser Herr Schiefler, und doch schlägt sein Herz für das deutsche Volk. Die Brücke zu Deutschland bilden für ihn die Musik und die Kultur. Familien, denen dieses Band fehlt, wie beispielsweise der Schlosser aus Kassel, den ich in seinem Hause besuchte, ge[339]hen in dem gleichen Zeitraum von dreißig Jahren ganz in der neuen Umgebung auf. In ihr übt die Mehrheitsmeinung einen starken Druck auf Anpassung aus. Die Familie des Schlossers pflegt kaum noch Beziehungen zu deutschen Verwandten. Obwohl sie sich Mühe gibt, ist ihr Deutsch holperig und mit vielen englischen Brocken durchsetzt. Ihr Lebensstandard ist hoch. Sie hat ein eigenes Haus, einen schönen, nach deutscher Art gepflegten Garten, einen schmiedeeisernen Gartenzaun, wie er in den USA nicht üblich ist, und ein eigenes Auto. "Mir geht es gut", sagt der Schlosser. "Hier kann man Geld verdienen, wenn man arbeiten will. In Kassel habe ich das Kunstschlosserhandwerk erlernt. Hier kann ich handwerklich nichts dazulernen, dafür aber umso mehr Geld verdienen. Wir sind in den Augen der Amerikaner doch nur die 'Sauerkrauts'. Na ja, schadet auch nichts, wir sind freie Bürger." Richmond, den 29. September 1953 Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und der großen Gegensätze. Man könnte rühmen, immer nur rühmen, und doch gibt es auch die kleine, halb verfallene Hütte, in der irgendeine schwarze Familie ärmlich ihr Leben fristet. So ist es in New York, so ist es in dem Land, das vor den Scheiben unseres Luxuszuges vorbeigleitet. Die mittleren und kleinen Landstädte bieten das gleiche Bild. Wunderbare, sich weit hinziehende Vorstädte mit herrlichen, eingeschossigen Häusern, ohne Umzäunung, mit sehr viel Platz, dahinter Parks oder öffentliche Wälder. Am Stadtrand gedrückte Negerviertel, bei denen man froh ist, wenn man wieder heraus ist. Dabei gibt es auch außerordentlich gut gekleidete, sehr gebildet wirkende schwarze Männer, anmutige, sehr hübsche schwarze Frauen, die ihre Reize geschickt zu betonen wissen. In einem jedoch gibt es keinen Gegensatz. Das Leben und die Arbeit sind voll motorisiert und mechanisiert. Die Farmen, der Straßenbau, die Fabriken, die Fahrstühle, die Eisenbahnen, die Küchen, alles ist technisch perfektioniert. Im Zuge nach Ames, den 3. Oktober 1953 In den USA gibt es kein Vorurteil gegenüber uns Deutschen. [340] Im Gegenteil: Sofern man merkt, daß wir Ausländer und insbesondere Deutsche sind, beginnt man eine Unterhaltung, fragt nach Wohin und Woher, fragt, wie es uns in Amerika gefällt, und wünscht uns gute Reise und viel Spaß. Als wir von Richmond nach Ames fahren, eine Bahnreise von über vierundzwanzig Stunden, hatte ich kuriose Erlebnisse. Im Speisewagen und im Clubwagen unseres Personenzuges hatte es sich schnell herumgesprochen, daß wir Deutsche sind. Ein freundliches Zunicken, besondere Zuvorkommenheit von allen Anwesenden zeigten, daß wir gern gesehene Gäste sind. Ein alter, seriöser Herr legte uns im Speisewagen mit einem freundlichen Lächeln einen Zettel auf den Tisch. Darauf stand: "Ich heiße Sie in unserem Land sehr herzlich willkommen." Der Zugführer machte jedes Mal im Vorbeigehen irgendwelche Bemerkungen. Als ich einmal meine Kamera zückte, um eine Aufnahme von ihm zu machen, sagte er: "Jetzt braucht Ihr Deutschen keine Angst mehr zu haben, daß wir Euch die Kameras und die Uhren wegnehmen. Die Zeiten sind vorbei." Es gehört sehr viel Selbstbewußtsein und Offenheit dazu, auf diese Weise an den Krieg zu erinnern, den die Amerikaner gegen uns geführt haben. Diese Art, eigene Fehler einzugestehen und dem ehemaligen Feind die Hand zu reichen, ist sehr gewinnend. Ames, den 4. Oktober 1953 Um neun Uhr holt uns Herr Boenke aus unserem Motel ab. Er ist der Sohn eines Ostpreußen und einer Berlinerin, spricht aber kein Wort deutsch. Wir gehen gemeinsam zur evangelisch-lutherischen Kirche, wo er uns seiner Frau und seinem vierjährigen Sohn vorstellt. Die Kirche ist zwar noch nicht sehr alt, wirkt aber in ihrer schlichten Architektur sehr würdig. Ames, eine Stadt mit dreißigtausend Einwohnern und achttausend Studenten, hat drei evangelisch-lutherische Kirchen. In unserer, die etwa einhundertfünfzig Sitzplätze hat, werden drei Gottesdienste am Sonntag gehalten. Die Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Es sind sehr viele Studenten anwesend, die das Bild des Gottesdienstes [341] bestimmen; aber auch das alte,in sich versunkene Großmütterchen fehlt nicht. Es hat im Unterschied zu unseren an dem schwarzen Hut eine knallrote Straußenfeder. Jeder Kirchgänger erhält einen Zettel mit dem Tagesgebet, den Liedernummern, wichtigen Hinweisen der Gemeinde und Buchbesprechungen von evangelisch-lutherischer Literatur. In den Gesangbüchern, die in den Bankreihen ausliegen, sind die meisten Kirchenlieder aus dem Deutschen übersetzt. Man singt nach der gleichen Melodie wie bei uns. Über den Chorälen stehen der Textdichter, Entstehungsjahr und die erste Zeile in deutscher Sprache. Der Pastor wirkt frisch, jung, sympathisch. Er schreitet nicht zur Kanzel, sondern geht rasch und sportlich. Über dem schwarzen Talar hat er in dreiviertel Länge und mit weiten Ärmeln einen weißen Überhang und eine grüne Schärpe, die um den Nacken fast bis auf die Erde herunterhängt. Die Predigt wird in einem frischen, ansprechenden Ton gehalten. Das Abendmahl schließt sich für diejenigen, die teilnehmen wollen, an den Gottesdienst an. Es sind dies etwa achtzig Prozent der Anwesenden. Das Vaterunser und der Segen beenden den Gottesdienst. Am Ausgang der Kirche steht der Pastor, begrüßt jeden Kirchgänger. Herr Boenke stellt uns vor. Mississippi, den 22. Oktober 1953 Wir haben mit Professor Stacy, dem Agrarsoziologen und Berater der Universität Ames, eine große Autofahrt gemacht. Sie führte uns über Desmoines, Washington, Swedesburg, Wellman, Kalona, Davenport, Amana zurück nach Ames. Es war eine Fahrt von etwa sechshundert Meilen. Professor Stacy hatte uns vor Jahresfrist in Hannover besucht. Wir hatten ihm die Niedersächsische Landwirtschaft und unser Beratungssystem gezeigt. Wir gewannen auf dieser Autofahrt einen guten Einblick in das Leben und die Landschaft des Staates Iowa. Erstaunlich aktiv ist die Beteiligung der Frauen am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben. Sie nehmen führenden Anteil an den unzähligen Organisationen, Vereinen und Bürgerinitiativen, die sich mit den Fragen der Erziehung und der Dorfentwicklung befassen. So waren in dem Bildungskon[342]zil des Staates Iowa, das wir in Desmoines besuchten, mehr als die Hälfte Frauen. Auch in der Gesellschaft der Eltern und Lehrer, die ihre Jahresversammlung in Davenport abhielt, überwog der Anteil der Frauen bei weitem. Beide Vereine beeinflussen Form und Inhalt der Jugenderziehung und Erwachsenenbildung. Immer wieder macht man die Beobachtung, daß das Leben des Amerikaners nicht so sehr vom Staat, als von freien Gruppen, Vereinen und Verbänden beeinflußt wird. Selbst die Kirchen sind freie Zusammenschlüsse, deren Wirken vom Staat völlig unabhängig ist. In ihnen wird das Evangelium und keine Politik gepredigt. So wird beispielsweise das Leben der ländlichen Dorfgemeinde Swedesburg, eine Siedlung von eintausendachthundert eingewanderten Schweden, sehr stark von der dort vorhandenen evangelisch-lutherischen Kirche bestimmt. Die Gemeinde hat neben einer sehr großen, gut ausgestatteten Kirche ein geräumiges Gemeinschaftshaus. In ihm sind vorhanden: ein Versammlungssaal, ein Eßraum und eine Küche. Hier treffen sich der Frauenclub, das Farm-Büro, der Vier-H-Club, der unserer Landjugend entspricht, und einige weitere Gruppen. Daneben finden in dem Gemeinschaftshaus Familienfeiern statt. Es ist ein Zentrum des ländlichen Lebens neben der Kirche, das man sich für jedes größere deutsche Dorf nur wünschen kann. Es findet fast an jedem Abend eine Veranstaltung statt. Vom Beratungsdienst aus versucht man, das dörfliche Leben zu aktivieren und die einzelnen Gruppen zu Dorfparlamenten zusammenzuschließen. Dadurch soll mehr Initiative zur Dorfentwicklung von unten her ausgehen. Bei einer solchen Versammlung lernten wir eine Deutsche aus Thüringen kennen, die seit einigen Jahren in den USA lebt. Sie hatte in der Bundesrepublik Deutschland einen Amerikaner kennengelernt und geheiratet. Sie leidet unter dem Einfluß der angelsächsischen Mehrheitsmeinung. Anläßlich des Vortrages von Professor Stacy über seine Deutschlandreise und bei der Beschreibung der Lichtbilder, die er bei uns gemacht hatte, merkte man deutlich, wie groß ihre Sehnsucht nach Deutschland ist. Ein Herr Swandsen, den wir an diesem Abend ken[343]nenlernten, ist auch von dem Wunsch beseelt, einmal nach Deutschland zu fahren. Sein Vater stammt aus Kiel und hat ihm sehr viel von seiner Heimatstadt erzählt. Iowa besteht zum größeren Teil aus schwarzem, humosem Steppenboden. Es werden, wenn der Regen ausreicht, sehr gute Ernten gemacht. Die Farmen in diesen fruchtbaren Ebenen sind sauber und reich. Sie liegen meist schneeweiß gestrichen wie an einer Perlschnur aufgereiht an den schnurgeraden Autostraßen, inmitten einer kleinen Baumgruppe auf ihrem eigenen Acker. Es gibt aber daneben auch weniger fruchtbare Gegenden, weit ab von der Bahn und der nächsten Stadt. Die Gebäude wirken hier ärmlich, und manchmal sind sie sogar halb verfallen. Wir waren in einem solchen Ort zu einer Versammlung des Lions-Clubs. Ein schöner, geräumiger Versammlungsraum im Keller der Kirche war gefüllt mit Mitgliedern des Vereins. Alle sind gut gekleidet, manchmal etwas geschmacklos für unsere Begriffe, mit unechtem, auffallendem Schmuck behängt. Aber sehr gute Gesichter und Erscheinungen sind darunter. Die Hälfte der Anwesenden sind Farmerfamilien. Der Vorsitzende des Clubs ist der Bürgermeister des Ortes, ein Postbeamter. Die langen Tische sind weiß gedeckt, es gibt ein gutes, vielseitiges Essen. Als Tischdekoration dienen Blumen und Feldfrüchte, die in Form von Stilleben sehr dekorativ und bunt arrangiert sind. Die Unterhaltung beim Essen ist lebhaft. Wir werden als die Gäste aus Germany vorgestellt, und es werden kurze Ansprachen gehalten. Der Club arbeitet mit den zuständigen Lehrern des nächstgelegenen College in den Fragen der Dorfentwicklung zusammen. Auf der Fahrt nach Davenport, einem größeren Industriezentrum und Eisenbahnknotenpunkt im Südosten Iowas, überqueren wir den Mississippi. Es ist ein gewaltiger, ungebändigt erscheinender Fluß. Infolge der Trockenheit dieses Jahres ist der Wasserspiegel sehr niedrig. Der Fluß hat ein sehr breites Bett und sehr viele Inseln. Sie sind häufig mit urwaldähnlichem Baumbestand bewachsen. Für die europäischen Dimensionen ist es eine gewaltige Landschaft. [344] Plötzlich begegnen wir einem Pferdewagen und einigen Einspännern. Es ist ein ungewohnter Anblick in Amerika. Die Wagen werden von Mennonitenfrauen in schwarzen, langen Trachtenröcken oder von Männern mit Bärten gefahren. Im engeren Umkreis von Kalona haben meist aus Deutschland ausgewanderte Mennoniten ihre Trachten, Sitten und ihr Brauchtum erhalten. Sie benutzen keine Autos und lehnen auch die Anwendung von Traktoren in ihren Farmen ab. Man sagt, daß sie gerade wegen der Ablehnung der Technisierung sehr reich seien. Ich frage zwei Frauen, die gerade ihre typische Kutsche besteigen, ob ich wohl eine Aufnahme machen könne. Sie lehnen es mit der Begründung ab, daß sie es nicht gerne sehen, wenn sie fotografiert werden. Sie wissen offensichtlich, daß ihr Widerstand gegen die Einflüsse der Mehrheit auf die Dauer aussichtslos ist, und fühlen ihre Lebensart bedroht. Der Staat tut nichts und läßt jedem einzelnen und auch jeder Gruppe seine Eigenart. Die Schule aber übt einen unmerklichen, dafür nachhaltigeren, unwiderstehlichen Einfluß aus. Sie ist die Hauptsäule der amerikanischen Gesellschaft und wird auf die Dauer gesehen auch diese Mennonitensiedlung in die uniforme amerikanische Gesellschaft einschmelzen. Man sagt uns auf der Straße, daß die Jugend sich mehr und mehr dem strengen Brauchtum entziehe und aus der Siedlung abwandere. Der Gefahr der Isolierung und des Absterbens alternativer Lebensformen scheint eine andere Gruppe deutscher Auswanderer besser begegnet zu sein: die deutsche Amana-Siedlung. Vor über einhundert Jahren war eine deutsche Sekte, die sich in Opposition zum dogmatischen Luthertum befand, nach Nordamerika ausgewandert. Sie hatten sich in straff organisierten, genossenschaftlichen Formen in der Nähe von Buffalo angesiedelt. Als sich hier immer mehr Industrie entwickelte und die Jugend begann, abzuwandern, entschloß man sich, vier Männer in das noch unbesiedelte Iowa zu entsenden. Sie kauften zehntausend Hektar besten Schwarzerdebodens. Die Mitglieder der Genossenschaft wurden dann nach und nach in die heute noch bestehenden Amana-Dör[345]fer umgesiedelt. Die gesamte Landfläche wird seitdem zentral bewirtschaftet, und es entstanden daneben eine Baumwollspinnerei, eine Möbelmanufaktur und eine Eisschrankfabrik. Jedes Unternehmen hat einen Vormann, der einen Sitz im Vorstand der Genossenschaft hat. Der Vorstand wird von den Mitgliedern gewählt, der seinerseits aus seinen Reihen den Präsidenten bestimmt. Bis zum Jahre 1932 wurde in den einzelnen Familien nicht gekocht, und auch die Wohnhäuser waren im Besitz der Genossenschaft. Nach einer großen, tiefgreifenden Reform in diesem Jahr wurden die zwölf Gemeinschaftsküchen, in denen je vierzig Personen aßen, aufgelöst und in öffentliche Gaststätten umgewandelt. Die Genossenschaftsmitglieder bekamen ihren Anteil ausgezahlt, so daß jede Familie ein Haus und Garten kaufen konnte. Seit diesem Zeitpunkt kann jeder einzelne studieren, wenn er genügend Geld hat und interessiert ist. Vor der Reform wurden nur ein Arzt und ein Zahnarzt auf Genossenschaftskosten zum Studium geschickt. Durch die Reorganisation hat die Genossenschaft offensichtlich erreicht, daß sich ihre Mitglieder in ihr wohl fühlen. Die Wohnungen, die Gaststätten, die Fabriken und Geschäfte machen einen ansprechenden Eindruck. Schilder laden den Fremden zur Besichtigung ein. In Druckschriften wird für die Erzeugnisse der Amana-Dörfer geworben und ihre Lebens- und Arbeitsformen erklärt. Alles strahlt einen gesunden Reichtum aus. Die Grundlage des modernen Gemeinwesens ist der gemeinsame Glaube. Die Predigt in der Kirche hält abwechselnd einer der sechs jährlich gewählten Kirchenvorsteher. In der Kirche und in den Familien wird deutsch gesprochen. In der Familie Noe beispielsweise erklärt uns selbst der kleine, zweijährige Juan das Bilderbuch in deutscher Sprache. Die Kinder werden zweisprachig erzogen. In der Schule lernen sie die Bibel deutsch lesen, sonst wird in englischer Sprache unterrichtet. Die Großeltern Noe sprechen ein klares, einwandfreies Deutsch, die Frau in sächsischer, der Mann [346] in hessischer Mundart, und dies in der dritten Generation nach der Auswanderung. Wir unterhalten uns über die Siedlung und ihre Eigenarten, über Deutschland heute und bedauern beiderseits, daß der Besuch nur so kurz sein kann. Knoxville, den 31. Oktober 1953 Wir gehen durch die Schule in Linwood in dem Staat Arkansas. Die Kinder werden frühmorgens mit dem Omnibus zur Schule gebracht, essen hier Mittag und werden nachmittags um fünfzehn Uhr wieder zurückgefahren. Der Unterricht in der Oberschule beruht auf Selbststudium, das von den Lehrern lose gesteuert wird. Das Wissen und Können ist nicht so hoch wie an deutschen Oberschulen. Man spricht sogar von alarmierenden Niveauverlusten, selbst für amerikanische Verhältnisse. Wir gehen in einen Klassenraum der Unterstufe. Die Lehrerin fordert uns mit Gesten auf, ruhig zu sein, denn auf der Erde liegen mehrere Kinder in Decken eingerollt und halten ein Schläfchen. Jedes Kind kann sich, wenn es müde wird, hinlegen. Der Unterricht geht mit gedämpfter Lautstärke weiter. Herr Wright, ein Lehrer dieser Schule, fragt uns nach den Erziehungsprinzipien in Deutschland. "Die Disziplin und die Selbstbeherrschung der Kinder in deutschen Familien sind, wie ich gehört habe, viel größer als in den Staaten. Ich finde das besser." Washington, den 3. November 1953 Gestern erzählte mir ein hoher Beamter im Landwirtschaftsministerium, daß die schwarzen US-Amerikaner in weiten Bezirken der Staaten keine stabile Familienstruktur hätten. Der Neger sei sehr emotional veranlagt und würde daher die Schranken, die eine Ehe setze, leichtfertig durchbrechen. Die Selbsthilfefunktion der Familie sei aber die Grundlage unserer Gesittung und Kultur. Auch bei der weißen Bevölkerung könne man besonders in den Großstädten einen Zerfall des Familienlebens beobachten. Die Kinder seien dabei die Leidtragenden. Die Frauen seien oft berufstätig, hätten viele, außerhalb der Familie liegende Interessen. Hinzu komme die Freiheit des Individuums, die die Erziehungsprin[347]zipien aufgeweicht hat. Die Kinder seien weitgehend den Schulen oder sich selbst überlassen. In Washington werde die Erziehungslosigkeit für das Wachsen der Jugendkriminalität verantwortlich gemacht. Soweit dürfe, meinte mein Gesprächspartner, die Freiheit der Person des Kindes natürlich nicht gehen. Die Kinder werden den Eltern gegenüber aufsässig und würden die öffentliche Meinung in der Straße gegen sie mobilisieren, wenn sie beispielsweise einmal verprügelt werden. Allerdings könne man erleben, daß ganz junge Menschen in Versammlungen aufstehen und unbefangen, ohne jede Hemmung, ihren frei gesprochenen Beitrag leisten. Das sei die positive Seite der liberalen Erziehungsprinzipien. Es ist mir nicht möglich, über das, was ich gesehen und gehört habe, eine abschließende Meinung zu bilden. Licht und Schatten liegen in den Vereinigten Staaten für mein Verständnis zu nahe beieinander. |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|