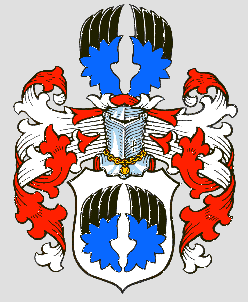
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Ursula floh aus Thorn mit zwei Söhnen und der achtzehn Tage alten Gudula |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
Meine Schwägerin Ursula sagte, als ich sie nach ihren Fluchterlebnissen fragte, ihr seien viele Einzelheiten entfallen, und fügte hinzu, daß man zum Glück das Schrecklichste vergesse. Vielleicht hatte sie es auch nur verdrängt. "Wir kannten", erzählte sie, "einen Stadtrat in Thorn sehr gut. Er sagte mir im Januar fünfundvierzig, ich solle zum Rathaus kommen, er wolle mir einen Passierschein ausstellen. Mit diesem Papier würde ich bei allen Kontrollen durchgelassen werden. So war es dann auch. Ich fuhr mit einem Auto und einem Chauffeur unserer Firma mit meinen drei Kindern ab. Es ist mir unverständlich, wie kopflos ich damals war, hatte nicht einmal den Kofferraum voll gepackt. Am wichtigsten waren mir Volker, Dietger, die erst achtzehn Tage alte Gudula und die Kindersachen. Mein Vater hatte mir ein Kindermädchen geschickt, die ich auch mitnahm. Wir fuhren zuerst nach Bagnitz bei Schwetz zu meinen Eltern. Dort fühlte ich mich sehr sicher und weit weg vom Schuß. Wir konnten in meinem Elternhaus nur vier Tage bleiben. Rund herum brannten die Dörfer, und die Kanonen ballerten. Meine Eltern kannten eine Familie, die bei Schneidemühl ein Hotel besaß. Mein Vater [242] beschrieb dem Chauffeur den Weg dorthin, und so fuhr ich mit den Kindern los. Das erste Mal übernachteten wir in Zempelburg. Am nächsten Tag fuhren wir weiter in Richtung Schneidemühl und erreichten das von meinem Vater empfohlene Hotel. Wir bekamen zwei schöne Zimmer mit weiß bezogenen Betten. Meine Freude darüber wurde aber dadurch getrübt, daß Dietger pausenlos schrie. Ich bestellte einen Arzt, der bei ihm eine Mittelohrentzündung feststellte. Mein Fahrer hatte mir noch am Abend gesagt, er müsse zu einer Werkstatt fahren, da am Auto etwas nicht in Ordnung sei. Als wir am nächsten Morgen weiter wollten und der Chauffeur nicht da war, rief ich in der Werkstatt an. Man gab mir die Auskunft, daß das Auto repariert worden, der Fahrer aber westwärts abgefahren sei. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich ließ im Hotel meine Tochter taufen. Der deutsche Rückzug nahm immer dramatischere Formen an, so daß ich überlegen mußte, wie ich mit den drei Kindern weiter nach Westen komme. Es rollten pausenlos Wehrmachtsfahrzeuge durch den Ort. Als eine Kolonne in der Nähe unseres Hotels hielt, fragte ich den zuständigen Offizier, ob er mich und die Kinder mitnehmen würde. Er erlaubte es. Da wir nicht alle auf dem Fahrersitz eines Lastwagens Platz fanden, ließ ich leichtsinnigerweise die beiden Jungen auf zwei verschiedene Lastwagen aufsteigen und setzte mich mit Gudula auf dem Arm in einen dritten LKW. Dessen sehr hilfsbereiter Fahrer, der aus Ostfriesland stammte, sagte mir, ich solle die Ringe von meinen Fingern abziehen und wegstecken, denn die Soldaten seien auch nicht alle so, wie ich vielleicht vermute. Die zweite Nacht verbrachten wir in einem Lager für russische Zwangsarbeiter östlich von Stargard. Es war sehr unruhig dort, denn Gudula fing an, nach dem Füttern zu brechen, und mich peinigte irgend etwas. Ich fragte einen der Soldaten, was es wohl sein könne, was mich immer so pieke. Der sagte: 'Was soll das schon sein. Es sind Wanzen.' Dann wurde Gudula sehr krank und bekam hohes Fieber. Eine Ärztin aus dem deutschen Lagerlazarett sagte mir, es sei hoffnungs [243]los und ich solle die anderen beiden Kinder retten. Als wir auf die Wehrmachtsfahrzeuge aufsteigen wollten, fing Volker herzzerreißend an zu schreien und rief immer wieder, wir könnten Gudula nicht allein zurück lassen. Wir fuhren aber doch ohne sie weg, bis wir in Stargard ankamen. Da auch Volker und Dietger erkrankten, lieferte der Fahrer uns dort im Krankenhaus ab.Der Arzt stellte fest, daß meine beiden Söhne Mumps hatten. Ich solle das ja niemandem sagen, denn sie müßten eigentlich auf eine Isolierstation. Niemand würde mich und die Kinder mitnehmen, wenn es bekannt werde, daß sie eine ansteckende Krankheit haben. Am nächsten Tag lief ich die Straße entlang und fragte einige Lastwagenfahrer, ob sie uns mitnehmen könnten. Sie lehnten alle ab. Dann kam ich zu einem Kleinomnibus der Feuerwehr des Ortes. Die Insassen erklärten sich bereit, mich mitzunehmen. Ich rannte so schnell ich konnte zum Krankenhaus zurück, packte meine zwei Koffer und sagte den beiden Jungen, sie sollten sich an meinem Mantel festhalten und mitlaufen. Dietger war damals anderthalb Jahre alt. Wir fuhren ab, und es war in dem Omnibus sehr kalt. Ich knöpfte den Mantel auf und ließ Dietger, der auf meinem Schoß saß, die Füßchen rechts und links nah an meinen Körper stecken. Auf einmal wurde der Motor abgestellt, das Licht ausgeschaltet, und es hieß, wir sollten uns alle ruhig verhalten, da russische Truppen in der Nähe seien. Nach einer gewissen Zeit fuhren wir wieder weiter und überquerten die Oder. In Kröslin, einem kleinen Dörfchen bei Wolgast, stieg ich aus dem Omnibus aus und blieb hier einige Wochen. Mein Vater hatte mir gesagt, er würde mit dem Treck nach Bublitz fahren. Ich schrieb ihm dorthin meine jetzige Adresse. Die Reichspost funktionierte in diesem Chaos wunderbar. Er bekam meine Nachricht und traf nach einigen Tagen mit vier Treckwagen bei uns ein. Unterwegs hatte er seine acht Pferde einmal in einem Stall untergebracht, der verseucht war. Sie wurden daraufhin krank, und er mußte vier von ih [244]nen zurück lassen. Mit nur zwei Treckwagen fuhren wir von Kröslin westwärts los. Da die englischen Tiefflieger am Tage auch Flüchtlingstrecks beschossen, fuhren wir immer nur nachts. Morgens hielten wir in einem beliebigen Dorf, das wir gerade erreicht hatten, an, gingen zum Bürgermeister und ließen uns von ihm ein Quartier anweisen. Das klappte immer sehr gut, denn die Bauern, zu denen wir geschickt wurden, nahmen uns hilfsbereit auf, ließen uns in der Küche das Essen zubereiten und in der Scheune schlafen. Wir hatten soviel Eßmarken mitgebracht, daß wir ausreichend Nahrungsmittel einkaufen konnten. Mehr als zwanzig Kilometer schafften wir aber in einer Nacht nicht.So kamen wir langsam, aber sicher bis Geesthacht an der Elbe. Hier blieben wir einige Tage bei einem Bauern. Dann setzten wir auf einer Fähre über die Elbe. Auf dem westlichen Ufer ging es steil hoch. An dieser Stelle wären wir beinahe verunglückt. Die Pferde waren so geschwächt, daß sie unseren Wagen nicht den Abhang hochzuziehen schafften. Er rutschte immer weiter zurück und wäre beinahe in die Elbe gefallen. Mein Vater sprang herunter und trieb die Pferde an, bis sie den steilen Berg hoch waren. Dann ging er zum zweiten Wagen und schaffte es, auch ihn hoch zu bekommen. An diesem Tage begegnete ich zum ersten Mal einer Kolonne völlig heruntergekommener Menschen. Ich war so naiv, mich zu erkundigen, was das für komische Gestalten seien. Da sagte man mir, es wären Insassen eines Konzentrationslagers. Kurz darauf lief mir eine hysterische Frau in die Arme, die allen Leuten erzählte, sie sei KZ-Aufseherin gewesen, und fragte mich, was nun wohl mit ihr geschehen würde. Anstatt sich zu verkrümeln und den Mund zu halten, rannte die Frau laut redend herum. Wir fuhren mit unserem Treck weiter in die Lüneburger Heide. Dort wurden wir von der Treckleitstelle in einem kleinen Dorf einquartiert. Mit Hans-Joachim hatte ich schon in Thorn vorsorglich verabredet, daß wir uns im Falle einer Flucht bei Bekannten in Vechelde bei Braunschweig treffen wollten. Dorthin schrieb [245] ich, als wir die Endstation unseres Trecks erreicht hatten. Er war nach seiner Entlassung aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft sofort dorthin gefahren, fand meine Nachricht vor und kam bald zu uns. Gemeinsam zogen wir nach Vechelde um und wohnten dort, bis wir durch Werner aufgefordert wurden, zu ihm nach Goddelau zu kommen."Als Ursula ihren Bericht beendet hatte, sagte Hans-Joachim zu ihr: "Du bist doch noch einmal zu Gudula zurückgefahren." "Ach ja", sagte sie und überlegte lange, ehe sie stockend weiter erzählte. "Aus Kröslin bei Wolgast, wo wir uns verhältnismäßig lange aufhielten, schrieb ich an das Lager bei Stargard und fragte dort an, wo Gudula beerdigt sei. Nach wenigen Tagen erhielt ich die Antwort, daß ein Wunder geschehen sei, Gudula lebe und ich sie abholen solle. Daß ich dies tat, war der größte Fehler meines Lebens. Ich fuhr bis Stargard. Den Rest des Weges, das waren noch viele Kilometer, mußte ich zu Fuß gehen. Als ich ankam, standen die Russen schon dicht vor der Ortschaft, deren Namen mir leider entfallen ist. Man gab mir Gudula, und ich wollte mit ihr im Zug nach Kröslin zurückfahren. Unterwegs wurde sie wieder krank, und ich mußte sie in ein Krankenhaus in Swinemünde einliefern. Schweren Herzens trennte ich mich ein weiteres Mal von ihr und fuhr zu meinen Eltern nach Kröslin weiter. Nach einigen Tagen wurde ich unruhig und holte Gudula aus Swinemünde ab. Dann hatte ich sie wenigstens bei mir. Sie war aber sehr krank und schrie immerzu. Nach ein paar Tagen brachte ich sie nach Greifswald in ein Krankenhaus. Als wir mit unserem Treck nach Westen aufbrachen, wollten wir über Greifswald fahren und sie wieder mitnehmen. Das taten wir dann auch. Die Schwester sagte mir aber, es sei unmöglich, das kranke Kind den Strapazen einer Treckfahrt auszusetzen, ich solle Gudula dort lassen und sie abholen, wenn der Krieg zu Ende sei. Sie versprach mir, sie inzwischen gut zu pflegen. Wir fuhren daraufhin ohne Gudula weiter. Kurz bevor die Rote Armee Greifswald einnahm, wurde das Krankenhaus noch evakuiert. Das war aber schon zu spät. Der Zug, in den es verladen worden war, wurde von den russi [246]schen Truppen überholt, die über die Krankenschwestern herfielen. Viele von ihnen liefen weg, versteckten sich in einem angrenzenden Wald und ließen die kranken Kinder in den Viehwaggons allein zurück. Der Zug fuhr dann später weiter, aber Gudula war am 17. Mai gestorben." |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|