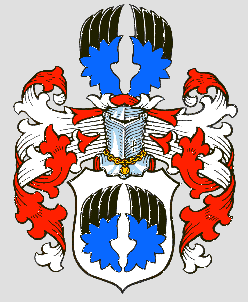
|
Horst Ernst Krüger:Die Geschichte einer ganz normalen Familie aus Altthorn in Westpreussen kommentiert und um Quellen ergänzt von Volker Joachim Krüger |
|
|
Leben in der Nische |
|
|
|
|
Die Zahl in blauer eckiger Klammer [23] bezeichnet in diesem Dokument immer den jeweiligen Seitenanfang in der Originalausgabe, die dem Herausgeber vorliegt. Hinter dem Falls Sie sich den Originaltext, um den es an der so bezeichneten Stelle geht, ansehen wollen, so werden Sie hier Mit diesem Zeichen mit diesem Zeichen Hier Und falls Sie mehr über die so |
Das Radio und die Deutsche Rundschau waren unsere täglichen Informationsquellen der politischen Vorgänge im Reich. Mein Vater hatte die Ostdeutschen Monatshefte abonniert und las sie regelmäßig. Es charakterisiert die redaktionelle Linie dieser Zeitschrift, daß im Textteil der Jahrgänge 1920 bis 1931 kein Wort über Hitler und die Nationalsozialisten zu finden ist. Im Heft vom Juni 1932 hatte der Herausgeber Carl Lange, der einmal zu einer Dichterlesung in Altthorn war, einen Artikel von Ernst Adolf Dreyer gebracht, der sich mit der Bedrohung des deutschen geistigen und kulturellen Erbes auseinandersetzte. Das Volk der Dichter und Denker sei seelisch und geistig erkrankt und befinde sich in höchster Gefahr, in Nationalismus und Nihilismus zu verirren. Eine Krise der deutschen Kultur drohe, wenn es nicht gelinge, die Tradition, die echten geistigen Werte, die "gesiebte Vernunft" des gesamten Volkes in die Zukunft hinüber zu retten. Als Hauptzeugen für die Bedrohung der deutschen Kultur zitiert der Autor Ricarda Huch, Ernst Robert Curtius, Albert Schweitzer und Alfred Döblin mit seinem Roman "Berlin Alexanderplatz". "Deutscher Geist vermag nur dann seine zeugende Kraft zu entfalten und im europäischen Schicksal gestal[142]tend einzuwirken, wenn er sich seiner Fundamente bewußt ist. Die Grundlage der europäischen und damit der deutschen Kultur beruht auf dem Primat des Christentums, das in allen Jahrhunderten tot geschrien wurde, um dann in erneuter Faszination wieder zu wirken." Im übrigen seien die Antike, der Humanismus und die Aufklärung europäischer kultureller Gemeinbesitz. Ohne den Nationalsozialismus beim Namen zu nennen, seien nach Meinung des Autors und unzweifelhaft auch des Herausgebers der Ostdeutschen Monatshefte Kräfte am Werk, die das religiöse Bewußtsein des Volkes durch einen irrationalen Mythos von Blut, Boden, Volkheit und Führerprinzip zu ersetzen versuchen. Der Kampf gegen Parteilichkeit, Verführung, Destruktion und Kulturhaß müsse mit geistigen Waffen geführt werden. In der jüngeren Generation seien Kreise vorhanden, die eine Synthese der konservativen und fortschrittlichen Ideen anstrebten. Sie versuchten, die unvermeidlichen Konflikte der Gesellschaft ohne Gewalt zu lösen und beachteten dabei die demokratischen Spielregeln. Aber "sie wissen, in welch häßliches Spiel ein gewisser Kreis der alten Generation sie wieder hinein locken möchte". Das war ein unmißverständlicher Aufruf zum Widerstand gegen Hitler. Der neunzigste Geburtstag meines Großvaters wurde in größerem Rahmen gefeiert. Opa hatte alle seine Verwandten eingeladen. Einige wohnten in Altthorn, die anderen in Berlin und in Hamburg. Der Geburtstagstisch wurde besonders festlich gedeckt. Die auswärtige Verwandtschaft hatte sich zum Kaffee eingefunden. Die eigentliche Geburtstagsfeier fand im Eßzimmer beim gemeinsamen Abendessen statt. Mein Vater saß an der Stirnseite der Tafel. Rechts daneben meine Mutter, dann mein Großvater und die Verwandten. Ich sehe ihn noch genau vor mir. Nach der Suppe sprach mein Vater sehr anschaulich, mit kleinen lustigen Geschichten gewürzt, über das Leben seines Schwiegervaters. Dabei erwähnte er auch die vielen gutgemeinten Ratschläge, die er von ihm bekommen habe. Opa hatte ihm einmal die dringende Empfehlung gegeben, er solle nicht einen guten Anzug anziehen, wenn er zum [143] Finanzamt fahre. Da müsse man die älteste Jacke und Hose tragen, denn dort werde man nach der Kleidung eingeschätzt. Dann erwähnte mein Vater die Geschichten von Opa in der Fohlenbox, wie er bis zum fünfundachtzigsten Lebensjahre es sich nicht hatte nehmen lassen, Obst von den höchsten Bäumen zu pflücken und wie er einmal von der Leiter herunter gefallen sei. Dann stand mein Großvater auf und hielt eine an meine Eltern gerichtete Dankrede. Er hielt sich dabei kerzengerade. Sein Leben sei trotz aller Enttäuschungen und Verluste schön gewesen. Er habe im Hause seiner Tochter und seines Schwiegersohnes viel gelacht, manchmal zuviel. Einen Tag nach diesem Geburtstag zog sich Opa wieder seinen guten schwarzen Anzug an und legte sich auf ein Sofa, mit der Bemerkung, seine Zeit sei nun abgelaufen. In den nächsten zehn Tagen hatte er alle ihm wichtig erscheinenden Anordnungen getroffen. Er wollte auf dem Gursker Kirchhof neben seinem Marthchen zur ewigen Ruhe gebettet werden und man solle bei seiner Beerdigung zwei Choräle singen, die er noch aussuchen werde. Am 10. Februar 1937 richtete er sich morgens wie gewohnt im Bett auf, ließ sich von meiner Mutter das weiße Oberhemd mit dem Stehkragen und den guten schwarzen Anzug anziehen. Als sie damit fertig war, sackte er in sich zusammen und war in den Armen seiner Tochter gestorben. "Wie sie so sanft ruhen, alle die Seligen", war einer der beiden Choräle, die er sich für sein Begräbnis ausgesucht hatte. Er wurde in der Gursker Kirche vierstimmig von seinen Nichten, Neffen und Enkeln gesungen. Wir standen auf der Empore gleich neben der Orgel, die von Hans Schedler, meinem Volksschullehrer, gespielt wurde, der in der Schule nur polnisch mit uns sprechen durfte. Am nächsten Tag fuhr ich nach Thorn. Um mich auf das Abitur vorzubereiten, wohnte ich in der Zeit bei meinen Brüdern in der Graudenzer Straße. Am Wochenende und in den Ferien war ich zu Hause auf dem Lande. Werner und Hans-Joachim hatten eine Firma gegründet und sie HAWEKA Die Mechaniker in der Werkstatt waren ausnahmslos Polen, auch der Nachtwächter. Ich kann mich nicht mehr an seinen Namen erinnern. Er endete jedenfalls nach zwei Silben mit ... owski. Oft schaute er breit grinsend durch unser Wohnzimmerfenster, wenn wir drei Brüder Abendbrot aßen. Er kannte unseren Appetit auf die in Thorn damals sehr beliebte Knoblauchwurst, die Knobloschka genannt wurde. Er erwartete dann den Auftrag, beim nächsten Fleischerladen eine solche Brühwurst für uns zu holen. Der Diensthabende legte sie dann in einen Topf mit kochendem Wasser, wartete, bis sie gar war und servierte sie formvollendet wie ein Kellner den beiden anderen Brüdern. Wir stürzten uns über sie her und verspeisten sie mit viel Mostrich. Wer glaubte, eine solche Knobloschka hätte unseren Hunger gestillt, hat sich getäuscht. Derjenige, der gerade Dienst hatte, öffnete das Fenster und rief in die Dunkelheit: " ... owski, noch eine Knobloschka." Nach zehn Minuten wurde sie vom Nachtwächter durch das Fenster gereicht. Auch sie war bald zubereitet und verspeist. " ... owski, noch eine Knobloschka", schallte es wieder über den Fabrikhof. An einem Abend hatten wir immerhin fünfmal nach ... owski gerufen. Eine Knobloschka wog ein rundes Kilo. Unserem Nachtwächter wurde das nicht zuviel. Jedes Mal reichte er die Wurst freundlich lächelnd durch das Fenster. Der alte Mann mit dem gutmütigen Gesicht versorgte uns wie eine Amme und freute sich, dem polnischen Fleischer in der Nachbarschaft noch in den Abendstunden zu [145] einer unerwarteten Aufbesserung der Tageskasse verhelfen zu können. Drei Junggesellen in einer Wohngemeinschaft sind wie ein Magnet für die Damenwelt. So ergaben sich vielerlei Kontakte zum schönen Geschlecht. Werner hatte Ilse Renn, eine Sachbearbeiterin des Deutschen Generalkonsulats, kennengelernt, Hans-Joachim Ursula Radtke, eine Klassenkameradin von mir, und ich traf mich oft mit Gerda v. Sprenger, die aus Posen an unser Gymnasium in Thorn übergewechselt war. Schüler von den deutschen Privatschulen in Posen oder Graudenz stießen häufig in den oberen Klassen zu uns, weil wir ein staatliches Gymnasium und unsere Lehrer berechtigt waren, ihre Schüler im Abitur zu prüfen. In den deutschen Privatgymnasien war es schwer, die Reifeprüfung zu bestehen, denn dort mußte sie vor einer staatlichen Kommission abgelegt werden. Der Kultusminister ernannte nur polnische Lehrer zu deren Mitgliedern, die nicht an den betreffenden deutschen Schulen unterrichteten. Oft hatten wir drei Brüder abends etwas besseres vor, als gemeinsam Knobloschka zu essen. Dann trafen wir uns mit unseren Freundinnen mehr zufällig bei einem Theaterbesuch oder einem Fest im Deutschen Heim. Die Deutsche Bühne, deren Aufführungen und Bälle wir besuchten, war ein Verein von Laienschauspielern, der in den siebzehn Jahren seines Bestehens dreiundachtzig Stücke inszenierte und dreihundertvierzehn Aufführungen veranstaltete. Zu jeder Spielzeit wurde ein neues Programm einstudiert und auf die Bühne gebracht. In jedem Jahr vor Weihnachten fand eine Märchenaufführung statt. An diese Märchen der Brüder Grimm knüpfen sich meine schönsten Kindheitserinnerungen. Außerdem standen die bekannten Dramen, Schauspiele und Komödien deutscher Dichter auf dem Programm. Mit Gerda traf ich mich zeitweise an jedem Nachmittag oder Abend. Wir gingen ins Deutsche Heim, um uns das Lustspiel "Der Etappenhase" anzusehen, das damals von der Deutschen Bühne gespielt wurde, trafen uns im Café Dorsch, gingen ins Kino oder machten stundenlange Spaziergänge. Sie war mir [146] eines Tages mit ihren langen, blonden Zöpfen auf dem Schulhof aufgefallen. Seitdem interessierte ich mich für sie. Die Leute, die sie kannten, weil sie mit ihr zusammen aus Posen zu uns gekommen waren, gaben mir über sie nur spärliche Auskünfte. Ich fragte weiter und weiter. Ja, ja, sagte man mir, ganz genaues wisse man nicht, aber das Mädchen habe eine schwere Kindheit gehabt und lebe mit ihrer Mutter in einer Stadtwohnung in Gnesen. Jetzt sei sie in Thorn in Pension. Ihrem Vater gehörten mehrere Güter im Kreisgebiet von Gnesen, aber er lebe nicht mit seiner Ehefrau, Gerdas Mutter, zusammen. Das sei eine geheimnisvolle Geschichte, die immer nur hinter der vorgehaltenen Hand erzählt werde. Ihr Vater sei ein typischer ostdeutscher Großgrundbesitzer, der nichts anderes als seine Güter und deren Verwaltung kenne. Seine Ehefrau dürfe ihn nicht besuchen, obwohl sie in der Kreisstadt wohne. Sie sei aus Mitteldeutschland nach Polen gekommen, damit die Tochter ihren Vater wenigstens ab und zu sehen könne. Auf unseren langen Spaziergängen haben wir viel miteinander gesprochen. Ihre Familiengeschichte hatte sie mir aber niemals erzählt. Wir waren oft das Weichselufer stromaufwärts gewandert. Die Straße in Richtung Jakobs Vorstadt steigt hinter der Eisenbahnbrücke steil an. Zur Weichsel hin fällt das Gelände ab. Dies war einer unserer Lieblingswege, denn die Aussicht über die Weichsel hinweg nach Rudak und darüber hinaus bis weit in den Truppenübungsplatz hinein übte auf uns einen seltsamen Reiz aus. Zu unseren Füßen lagen nach Treposch zu die beiden schwimmenden Boote des Rudervereins, dessen Mitglieder wir wurden. Wir machten schon bald mehrere Rudertouren zusammen, die weiteste bis zur Drewenzmündung. Von hier konnten wir die Ruine der Kreuzritterburg Zloterie liegen sehen. Wir ruderten hin und kletterten in dem alten, verfallenden Gemäuer herum, bestaunten die Feldsteintreppen, die in das Obergeschoß führten. Warum, so überlegten wir, die Stufen so breit und so niedrig seien. Das liege doch auf der Hand, sehe man auf den ersten Blick. Weil die Ritter in das erste Stockwerk der Burg gelangen wollten, ohne von ihren Pferden [147] absteigen zu müssen. "Nur so zum Spaß?" fragte Gerda. Die werden schon gewußt haben, warum. Was geht uns das an, antwortete ich. Man muß nicht bei allem und jedem nach dem Warum fragen. Aber, fügte ich hinzu, warum haben sie die Burg an diesen südlichsten Punkt ihres Ordensstaates gebaut? "Schau mal, die Aussicht über die herrliche Landschaft, dort unten die Drewenz und weiter hinten ahnt man die Weichsel. Das ist die Erklärung", rief Gerda begeistert. Die ganze? fragte ich. "Nein, das ist nicht die erschöpfende Antwort, aber eine von den möglichen. Die Ritter hatten eben noch Sinn dafür, das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden." Wir mußten an die Rückfahrt denken, wenn wir noch vor Einbruch der Dunkelheit das Bootshaus erreichen wollten. "Stromabwärts geht's schneller und leichter", sagte Gerda. "Die Herfahrt war ganz schön schwer." Am nächsten Abend sahen wir uns schon wieder. Wir gingen die Straße entlang, von der aus man die Bootshäuser von oben sehen konnte. Gerda setzte sich, zog die Beine an, faltete die Hände über den Fußknöcheln und legte ihr Gesicht auf die Knie. Vor uns tief unten die Weichsel. Ich finde das Leben sehr interessant, sagte ich. Du hast mich neulich bei unserer letzten Fete etwas gefragt, was viele junge Mädchen wissen wollen. Was ist schon das Abitur? Reifeprüfung nennt man es. Werden wir reif sein, aus der Nische des Labyrinths heraus zu finden, in der wir leben? Die Zeit ist nicht so, daß man an eine Verlobung denken kann. Das mußt Du verstehen. Wie wenig weiß ich von dem, was wichtig ist. Es wird noch Jahre dauern, bis ich meine Berufsausbildung beendet habe. Dann werden wir weitersehen. Gerda schwieg. Sie war mir böse. Ich neigte mich langsam zu ihr herüber, bis meine Stirn ihren immer noch auf den Knien ruhenden Kopf berührte. Sie wendete mir dann ihr Gesicht zu. Ihre Augen, ihr Mund, ihre Nähe, dachte ich, wie sehr liebst du sie. Sie stand plötzlich auf, drückte mir kräftig die Hand, als ob sie eine Freundschaft besiegeln wollte, nicht mehr. Ich brachte sie zu Ihrer Pen[148]sion. Wann sehen wir uns wieder, morgen um die gleiche Zeit? fragte ich und sagte ihr nicht, daß vierundzwanzig Stunden nicht in ihrer Nähe zu sein, eine unendliche Zeit für mich war. "Also bis morgen", sagte sie kühl. So trafen wir uns fast täglich bis vier Wochen vor meinem Abitur. Mein Vater machte mir zum bestandenen Abitur ein großzügiges Geschenk. Es waren fünfhundert Zloty, die er mir mit der Bemerkung gab, ich sei der erste in der Familie, der das Abitur gemacht habe, worüber er sich sehr freue. Wir deutschen Abiturienten des Jahrganges 1938 waren tagsüber auf der Breiten Straße mit unseren roten Mützen nicht zu übersehen. Nachts benahmen wir uns in den Gaststätten und in dem einzigen Nachtlokal der Stadt nicht weniger auffällig. Unsere polnischen Mitbürger nahmen keinen Anstoß daran. Gerda wurde als meine Freundin zu allen Feten mit eingeladen. So auch nach Altthorn, wo wir ausgelassen eine Nacht lang tanzten. Beinahe wäre ich zum eigenen Abifest in meinem Elternhaus zu spät gekommen. Ich mußte ein Taxi nehmen, denn ich hatte meinen Rausch der letzten Nacht noch nicht ausgeschlafen. Bisher war mir Trunkenheit unbekannt. Jetzt fühlte ich mich in diesem Zustand losgelöst von allen Zwängen und Konventionen, durfte Mensch sein und fühlte mich klüger, ritterlicher und reicher, als ich wirklich war. Nach vierzehn Tagen schaute ich in mein Portemonnaie und siehe da, es war leer. Eines Tages sagte Gerda, wir trafen uns wieder so oft wie möglich, Swistek habe ihrer Klasse einen Hausaufsatz aufgegeben, der ihr viel Mühe mache. Unsere Treffen müsse sie für zwei oder drei Tage aussetzen, denn sie sei an den Abenden mit dem polnischen Aufsatz beschäftigt. Ich machte ihr das Angebot, den Aufsatz für sie zu schreiben, dem sie sofort zustimmte. Gerda übertrug meinen Entwurf in ihr Schulheft und übergab es Swistek am nächsten Tag. Nachdem dieser die Aufsätze korrigiert hatte, verteilte er die Hefte und übergab es Gerda grinsend. Sie schlug es auf und traute ihren Augen nicht. Er hatte mit roter Tinte unter den Aufsatz geschrieben: "Eins. Da der Aufsatz mit fremder Hilfe ge[149]schrieben worden ist, vier." Eins war damals im polnischen Schulwesen die beste und vier die schlechteste Note. |
|
|
|
|
zurück: |
|
|
weiter: |
|
![]() Volker J. Krüger, heim@thorn-wpr.de
Volker J. Krüger, heim@thorn-wpr.de
letzte Aktualisierung: 08.08.2006